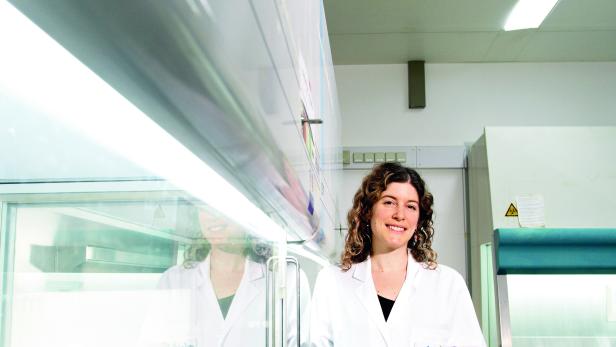
"Alles hängt von den Publikationen ab. Ohne die kannst du die Karriere vergessen." (Nana Naetar, Wissenschafterin)
"Alles hängt von den Publikationen ab. Ohne die kannst du die Karriere vergessen." (Nana Naetar, Wissenschafterin)
Universität: Jungwissenschafter unter Publikationsdruck
Großer Aufruhr im Frühsommer vergangenen Jahres: Die junge Wissenschafterin Haruko Obotaka hatte in einer bahnbrechenden Studie entdeckt, dass man Zellen mithilfe von Zitronensäure verjüngen kann. Nach wenigen Monaten war die Euphorie verflogen. Die Studie wurde als gefälscht enttarnt, Obotaka musste ihre Arbeit aus dem Wissenschaftsjournal "Nature“ zurückziehen. Der Ko-Autor der Studie, Yoshiki Sasai, beging einige Monate darauf Selbstmord.
Der Vorfall schockte nicht zuletzt derart, weil er daran erinnerte, wie groß das Vertrauen der Menschheit in die Legitimation durch Wissenschaft ist. Wird dieses Vertrauen strapaziert, ist die Empörung groß. Dabei sind Fälschungsskandale wie dieser nur der extreme Ausdruck eines Wissenschaftssystems, das von allzu menschlichen Wünschen nach Reputation, Erfolg und Ansehen beherrscht wird.
"Publish or Perish“ - frei übersetzt: "publiziere oder krepiere“ - heißt in der Wissenschaftsgemeinde der Druck, den aspirierende und etablierte Wissenschafter gleichermaßen kennen. Im Kampf um knappe Forschungsgelder und beruflichen Aufstieg zählen zwei Dinge: die Anzahl der Publikationen in wissenschaftlichen Journalen und die Bedeutung ebendieser Publikationen gemessen am "Impact Factor“ (dieser zeigt an, welche Beachtung einem Magazin in der Wissenschaftswelt zukommt).
Tendenz zum positiven Ergebnis
Je höher der Impact Factor eines Magazins, desto selektiver werden die Herausgeber - und weisen bis zu 90 Prozent der eingereichten Studien ab. Was zählt, ist die große Story. Und spätestens hier verabschiedet sich die Wissenschaft immer öfter vom ethischen Grundgedanken ihrer Disziplin: Anstatt der Qualität einer Forschung - also die Robustheit der Daten oder der Vorgang der Analyse - ist ein überraschendes, positives Ergebnis ausschlaggebend für die Veröffentlichung, Tendenz steigend: Hatten 1990 70 Prozent aller veröffentlichten Studien ein positives Ergebnis, so sind es heute bereits über 90 Prozent.
In der Pharmaziebranche fände man diese Verzerrung am häufigsten, so Gerhard Fröhlich von der Johannes Kepler Universität in Linz: "Bei einer pharmazeutischen Veranstaltung werden drei Studien vorgestellt, die einem Medikament Wirksamkeit nachweisen, und drei, die keine Wirkung finden. In den Journalen werden Sie aber bloß Berichte über erstere Ergebnisse finden.“
Von Wissenschaftern zu verlangen, negative Resultate ebenso faszinierend zu finden wie bahnbrechende Neuentdeckungen, wäre naiv, meint Daniele Fanelli, der an der Stanford-Universität über Fehlverhalten in der Wissenschaft forscht. Dennoch sei es besorgniserregend, wie stark der Trend, negative Resultate auszusparen, im letzten Jahrzehnt zugenommen habe. In der Wissenschaftstheorie nimmt die Falsifikation nämlich eine zentrale Rolle ein: Sie widerlegt Theorien und zeigt Kollegen, dass jemand bereits diesen Weg beschritten hat, dass aber nichts zu finden war, also ein weiteres Kreuzchen auf der weißen Karte der Forschung.
Unter dem Druck der knappen Ressourcen geht diese kooperative Grundhaltung jedoch zunehmend verloren. Nicht nur Magazine drucken lieber positive Studien, auch Forscher reichen hauptsächlich "erfolgreiche“ Experimente ein. "Negative Ergebnisse werden zurückgehalten, um niemandem einen Startvorteil zu geben. Schließlich hat man Zeit mit der Recherche vertan, und Kollegen vor leeren Kilometern zu warnen, würde ihnen erlauben, dich von rechts zu überholen“, erklärt der TU-Doktorand Markus - der nicht wirklich Markus heißt, aber aufgrund seiner bevorstehenden Dissertationsverteidigung in wenigen Wochen lieber anonym bleiben möchte - das neidvolle System der wissenschaftlichen Elite. Außerdem sei da noch die Angst, sich lächerlich zu machen. "Irgendein kluger Kopf wird sich immer lustig über das Experiment oder die statistische Analyse machen. ‚Ist ja klar, dass das nichts werden konnte, das sieht ja ein Affe auf den ersten Blick‘, heißt es dann“, weiß Markus. Fazit: Aufgrund des großen Drucks und Wettbewerbs in akademischen Sphären gingen Wissen, unzählige Gelder und Monate intensiver Arbeitszeit verloren und um gewagte Forschungsgebiete würden große Bogen gezogen werden, bemängelt etwa der Wissenschaftsethiker Gerhard Fröhlich.
Anzahl der Publikationen zählt
Bereits Doktoranden müssen mindestens drei Veröffentlichungen vorweisen können. Wer eine wissenschaftliche Karriere anstrebt, für den steigern sich die Herausforderungen proportional. Im sogenannten Tenure-Track, dem Weg zur Fixanstellung, zählt beinahe ausschließlich die Anzahl der Publikationen, und in Holland etwa werden Fördergelder und Rankingplätze der Universitäten nach der Publikationsanzahl ihrer Professoren verteilt. Ganz so schlimm ist es hierzulande noch nicht, dennoch gilt es, zu publizieren, teils auch mit fragwürdigen Mitteln.
Seit Langem klagt die Wissenschaft über eine "Replikationskrise“, in der sich nur ein minimaler Anteil der veröffentlichen Resultate nachstellen ließe. Je bedeutender das Journal und aufsehenerregender die Studie, desto seltener führen Wiederholungen zu denselben Ergebnissen. In einer großangelegten Überprüfung der Krebsforschung im Jahr 2012 konnten gerade einmal sechs von 53 bahnbrechenden Studien nachgestellt werden.
Seine Arbeit aus Versehen auf einem nicht-replizierbaren Experiment aufzubauen, ist ein Grauen für alle Jung-Wissenschafter im Wettkampf gegen die Zeit. Am Institut für Krebsbiologie an der Harvard Medical School in Boston, Massachusetts, an der die Österreicherin Nana Naetar fünf Jahre lang forschte, sprach man etwa voller Mitleid über jenen Kollegen, der unwissentlich seine Dissertation auf einem gefälschten Experiment aufgebaut hatte. Beinahe ein Jahr verbrachte er mit dem erfolglosen Versuch, die Ergebnisse der Studie zu replizieren.
Seit mit der Krise von 2008 auch in den USA die verfügbaren Forschungsgelder massiv zurückgegangen sind, hat sich der Zeit- und Performancedruck vergrößert. "Get it done and suck it up“ - auf gut Deutsch: "Mach den Job und halt den Mund“ - laute das Motto an einer der besten Forschungsstätten der Welt. Über 60 Stunden im Labor zu arbeiten, sei keine Seltenheit, berichtet Naetar. Auch an Wochenenden werde Anwesenheit erwartet. In diesem angespannten Klima kommt es zu Schlafmangel und Depressionen; allgegenwärtiges Misstrauen führe dazu, dass Kollegen abends ihre Forschungsprojekte einsperren. "Alles hängt von den Publikationen ab. Ohne die kannst du die Karriere vergessen“, weiß Naetar. Kolleginnen wurden sogar aus dem wohlverdienten Urlaub zurückgerufen, um eine Forschung zu beenden - ",sonst stellt ein anderer sie für dich fertig‘, haben die Professoren gedroht“, so Naetar. Inzwischen habe sich eine illegale Praxis an der Uni eingebürgert: Mit dem Argument, dass die Fördergelder ausgelaufen sind, entlassen Studienleiter ihre Projektmitarbeiter nach zwei bis drei Jahren, erweisen sich aber als gnädig genug, das Visum für internationale Forschende weiterhin zu bezahlen. So können die meisten ihre Forschungsarbeit fertigstellen, allerdings ohne Bezahlung. Denn als Arbeitsloser an einer Publikation weiterzuarbeiten, ist immer noch besser, als gar keine zu haben.
Als Naetar vergangenes Jahr ihren Sohn zur Welt brachte, beschlossen sie und ihr Mann, nach Österreich zurückzukehren. An der Medizinischen Universität hatte sie eine Anstellung gefunden: "Hier sind die Zustände doch etwas entspannter.“
"Kein Geld mehr da"
Fragt sich, wie lange noch. Dass es in Österreich auch nicht mehr so lauschig zugeht, berichtet Doktorand Markus: "Inzwischen schreibt die Uni Dissertantenstellen für 20 Wochenstunden aus - dabei weiß jeder, dass wir mehr als das Doppelte arbeiten.“ Da die Universitäten kein Geld mehr zur Verfügung hätten, würde der Wert der Mitarbeiter danach bewertet, wie viele Drittmittel sie eintreiben. Auch hierzulande sei es Norm geworden, die Kosten für Dissertanten an den Staat auszulagern: "Nach drei Jahren erklärt der Studienleiter, dass kein Geld mehr da ist“, berichtet Markus. Dissertanten beenden ihre Forschung dann in der Bildungskarenz - für ein Gehalt, das in Äquivalenz zum Arbeitslosengeld steht. Markus allein kennt sieben oder acht Leute, die diesen Weg wählen mussten.
Der rascheste Weg aus dem Prekariat führt über eine lange Publikationsliste. Dafür müsse man den Journalen eben eine gute Story bieten. "Um Aufmerksamkeit zu lukrieren, zwingt einen das gegenwärtige System geradezu, Ergebnisse in Schwarz-Weiß zu präsentieren“, bemängelt Nana Naetar. Kosmetische Verschönerungen seien im Wissenschaftsalltag inzwischen die Norm. Die Techniken müssen nicht zwingend illegal sein, das Ergebnis könne auch durch bewusst angewandte Techniken größer wirken, indem man etwa die zweckdienlichste Analysemethode im Nachhinein auswähle. Andere Forscher entfernen wiederum schnell ein paar Ausreißerdaten, um das Ergebnis homogener erscheinen zu lassen.
Erleichternd hierbei sind die Rahmenbedingungen: Obwohl jede Studie vor der Veröffentlichung von einem Kollegenteam abgesegnet werden muss, hält sich die Kontrolle in Grenzen: "Meist sind diese Forscher selbst damit beschäftigt, ihrerseits Studien zu veröffentlichen, und können allein aus zeitlichen Gründen die Resultate nur überfliegen. Niemand hat Zeit, die Rohdaten zu überprüfen“, meint Mark Maslin, Geografieprofessor am University College London. "Zudem spielen interne Faktoren wie Status der Autoren oder zwischenmenschliche Fehden eine große Rolle, ob eine Studie veröffentlicht wird.“
Maslin ist im Frühling als Editor von "Nature“ zurückgetreten. Mit diesem Akt des Protests will er ein Zeichen gegen das jüngste Symptom der Publish-or-Perish-Mentalität setzen: Denn um schnellere Publikationen zu ermöglichen, führte das Magazin ein System ein, das gegen Aufpreis eine schnellere Freigabe durch bezahlte Kritiker gestattet. Maslin befürchtet, dass dies den ersten Schritt zu einem Zwei-Klassen-System darstellt: Erfolgreiche und gut verdienende Wissenschafter können nämlich so schneller und öfter publizieren als jene, die Monate auf Rückmeldungen warten müssen.
Inzwischen haben sich Gegenbewegungen zu dem Publish-or-Perish-Druck gebildet. Eine ganze Reihe neu gegründeter Journale, etwa das "Journal of Negative Results in Biomedicine“, haben es sich zum Ziel gemacht, die Bedeutung der negativen Ergebnisse zu fördern, und die Initiative "San Francisco Declaration on Research Assessment” (DORA) fordert den Allmachtstatus des Impact Factors heraus.
Open-Source-Magazine, auf die gratis zugegriffen werden kann, werden wiederum von den einen als Hoffnungsträger, von den anderen als problematisch angesehen. Einerseits erlauben sie eine größere Bandbreite an Veröffentlichungen, die sich nicht mehr bloß auf die aufsehenerregendsten Ergebnisse zuspitzen. Andererseits bleibt die Frage offen, wer die Masse an Studien kontrollieren soll, zumal asiatische Arbeiten vermehrt auf den Markt stürmen. Grundsätzlich gilt: Wer schummeln will - und sich dabei nicht so auffällig benimmt wie Stammzellenforscherin Haruko Obotaka -, dem wird es nicht allzu schwer gemacht. Das Resultat ist eine verzerrte Wissenschaft, die ihrem eigentlichen Sinn nicht mehr entspricht. Dieser wäre natürlich, nach bestem Vermögen die Wahrheit abzubilden.