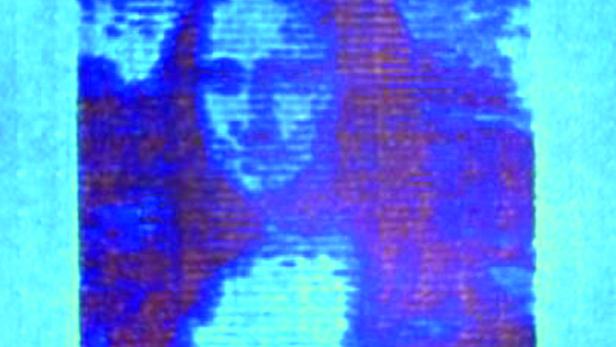
MINIATUR-MONA-LISA: Dänischen Forschern gelang das Kunststück, das Gemälde auf einer Größe von 50 mal 50 Mikrometer darzustellen.
MINIATUR-MONA-LISA: Dänischen Forschern gelang das Kunststück, das Gemälde auf einer Größe von 50 mal 50 Mikrometer darzustellen.
Nanoplasmonik: Die Tür zu einer faszinierenden Mikrowelt
Wahrscheinlich ist es das bekannteste Bild der Kunstgeschichte: die Mona Lisa, Leonardo da Vincis nur 77 Mal 53 Zentimeter großes Gemälde. Fast könnte man es hinter seinem trüben Panzerglasvorbau übersehen. Denn ständig stehen hordenweise Menschen davor, die fotografieren - heutzutage häufig sich selbst, mit dem Rücken zum Bild.
Wie wäre es, eine Kopie dieses Bildes auf der Fläche eines Haarquerschnitts darzustellen, in einem Rahmen von nur 50 Mal 50 Mikrometer, also zehntausendfach kleiner als das Original? Das ist tatsächlich möglich, auch wenn das Bild dann niemand mehr sehen könnte, selbst mit einer Lupe nicht. Die Idee der Miniatur-Mona-Lisa ist auch nur eine Demonstration, die vermitteln soll, was mit einer neuen Technologie im Hinblick auf Bildelemente möglich ist: mit der Nanoplasmonik. Einer dänischen Forschergruppe gelang dieser Coup - und damit eine neue Dimension in der Technik von Datenspeicherung und Laserdruck. Ein solches Abbild stellt jedoch nur eine von einer Fülle neuer Möglichkeiten dar, die diese Methode verspricht.
Derzeit dringen Nanospezialisten auf eine völlig neue Art in Mikrowelten vor, denn wer das Allerkleinste beherrscht, meinen sie, erobert einmal auch das Große. Das Gebiet sprüht gewissermaßen vor Ideen und innovativen Entwicklungen. Nach intensiver Forschung in Labors zeichnen sich heute Anwendungen ab, die tatsächlich unseren Alltag verändern könnten. Das betrifft nicht nur hochauflösende Laserdrucker, sondern auch Bio-Nanosensoren ungeahnter Empfindlichkeit, Solarzellen mit höheren Wirkungsgraden, Krebstherapie, Nanorobotik und die Quantentechnologie.
Kleiner als Lichtwellenlängen
Was steckt dahinter? Physikalisch geht es darum, Licht auf Dimensionen zu konzentrieren, die kleiner sind als die Wellenlänge des Lichts. "Nano“ ist nicht nur das griechische Wort für Zwerg, sondern bedeutet auch Milliardstel. Die Einheit Nanometer, also Milliardstel Meter oder Millionstel Millimeter, vermisst auch die Welt der Atome. Licht schwingt mit größeren Wellenlängen von einigen Hundert Nanometern. Lange galt als gesichert, dass sich unterhalb der halben Wellenlänge des Lichts Objekte nicht mehr voneinander unterscheiden lassen. Physiker sprechen von der Beugungsgrenze. Doch diese fundamentale Barriere fiel, als es Forschern gelang, aktiv mit Partikeln zu hantieren, die bei Durchmessern von zehn bis 100 Nanometern deutlich kleiner sind als die Lichtwellenlängen.
Trifft nun Licht auf winzige Metallpartikel, zumeist aus Gold oder Silber, regt es in den äußeren Schichten des Edelmetalls kollektive Schwingungen der Elektronen an, die Plasmaschwingungen oder Plasmonen genannt werden. Licht wird dabei in eine Elektronenwelle konvertiert. Das funktioniert am besten, wenn das Licht die gleiche Frequenz hat wie das Elektronenplasma der Nanoteilchen. Ähnlich wie Wasserwellen entstehen diese winzigen Anregungen direkt an der Oberfläche der Nanopartikel.
Bei der sogenannten Resonanzfrequenz schaukelt Licht die Elektronenkollektive am effektivsten hin und her. Sie streuen oder verschlucken das Licht und strahlen es wieder ab. "Dieser Effekt macht die plasmonischen Nanopartikel so besonders und unterscheidet sie völlig von anderen Materialien“, sagt Ortwin Hess. Der Nanophysiker ist Kodirektor des Centre for Plasmonics & Metamaterials am Imperial College in London. "Sie können die Energie der aufgefangenen Lichtwellen auf winzigstem Raum in eine Kollektivbewegung von Elektronen umwandeln, und zwar um Größenordnungen besser als alle anderen Systeme.“
Indem die Lichtfelder mit den Elektronenschwingungen in Metallen gekoppelt werden, lassen sich umgekehrt auch die Eigenschaften von Licht mit der Präzision von Nanometern steuern. Die Erwartungen an diese Technik sind groß, vor allem weil die Oberflächen-Plasmonen das Licht mit einer Effizienz absorbieren und streuen können, die Farbmoleküle oder andere Nanoteilchen deutlich übertrifft. Die Resonanzfrequenz, bei der das passiert, lässt sich nämlich durch die Form und Größe der Nanoteilchen über weite Strecken verändern. Das wieder ausgesandte Licht kann zum Beispiel in ganz anderen Farben leuchten und in andere Richtungen strahlen als die eingestrahlten Wellen.
Was die Nanoforscher daran so fasziniert, ist die Möglichkeit, mit diesen Oberflächen-Plasmonen zu experimentieren und sie auf vielfältige Anwendungen hin zu trimmen. Seitdem können sie künstliche Substanzen mit optischen Eigenschaften herstellen, wie sie in der Natur nicht vorkommen.
Riesiger Bedarf
Eine Wirkung ihrer Künste versprechen sich die Nanoplasmoniker bei Biosensoren - winzigen Gebilden, die auf bestimmte Moleküle oder Bakterien reagieren. Der Bedarf daran wäre riesig: beispielsweise für personalisierte Medizin oder farbbasierte Früherkennung von Epidemien fern von Kliniken. Am Markt existiert bisher lediglich ein Biosensor mit plasmonischen Nanopartikeln: ein Testgerät zur frühen Diagnostik von Schwangerschaften für zu Hause ("Clearblue“). Darin reagieren mit einem Antikörper beschichtete Goldkügelchen auf Schwangerschaftshormone. Auf einer Funktionsoberfläche lassen sie sich mit bloßem Auge allein durch ihre intensive Färbung erkennen. Ähnlich sollen Biosensoren für den Nachweis von Prostatakrebs, HIV-Aids oder Diabetes funktionieren.
Auch gegen Krebs wollen Forscher ihre Plasmonen in Stellung bringen. Das Zauberwort heißt thermische Phototherapie. Die Idee der Hyperthermie, Tumore so lange zu erhitzen, bis sie daran zugrunde gehen, wird von Ärzten seit 100 Jahren gepflegt und genießt heute einen eher zweifelhaften Ruf. Doch mit Gold beschichtete Nanostäbchen oder Nanokügelchen bieten neue Optionen: nämlich Tumorzellen gezielt zu attackieren und per Licht zu erhitzen, ohne zugleich gesundes Gewebe zu schädigen.
Nanopartikel lassen sich, wenn deren Oberfläche mit speziellen Peptiden bestückt sind, viel zielgenauer zu den Tumorzellen leiten, wo sie mit Infrarotlicht bestrahlt werden können, das Gewebe am besten durchdringt. Die Goldhülle der Teilchen verwandelt Infrarotstrahlen in Wärme, die den Tumorzellen den Garaus machen soll. Alternativ können die Kügelchen auch mit Wirkstoffen beschichtet werden. Sobald sie den Tumor erreicht haben, würden Infrarotstrahlen das Medikament ausschütten und so die Tumorzellen bekämpfen.
Noch sind diese Dinge im Laborstadium. Es gibt Versuche an Leberzellen von Mäusen, Experimente mit lebenden Mäusen sollen folgen. Ortwin Hess sieht noch viel Arbeit auf die Forscher zukommen: "Für eine Krebstherapie mit Nanopartikeln müssten wir erst einmal direkt mit Medizinern kooperieren, um potenzielle Therapien für Menschen zu entwickeln.“
Etwas weiter fortgeschritten scheint der Stand der Wissenschaft bei neuartigen Solarzellen, der plasmonischen Photovoltaik. Die Hoffnung ist, gegenüber den kristallinen Siliziumzellen den Wirkungsgrad zu steigern, der bislang bei rund 15 Prozent liegt. Forscher konnten zeigen, dass sich mit Nanoplasmonik der Wirkungsgrad bei Solarzellen prinzipiell dramatisch erhöhen lässt. Sie konvertieren das einfallende Licht mithilfe von Plasmonen in nichtthermische "heiße Elektronen“ und dann in Elektrizität. Dabei nutzen sie dünne Filme von 20 Mikrometer Dicke, nur ein Zehntel der Dicke von herkömmlichen Siliziumkristall-Wafern. Das spart 97 Prozent an Material und hält dennoch den Wirkungsgrad bei etwa 15 Prozent. Alternativ experimentieren Physiker mit Mehrschichtsystemen, von denen jedes einen etwas anderen Ausschnitt des Lichtes absorbiert. Damit sollen Wirkungsgrade von bis zu 50 Prozent erreichbar sein.
Miniatur-Mona-Lisa
Und was ist mit Mona Lisa? Das Geheimnis ihres Lächelns bleibt gewahrt, auch wenn es auf ein Millionstel ihrer Originalgröße reduziert wird. Die Miniaturisierung des Bildes auf Haaresbreite eröffnet die Möglichkeit, Bilder auf so kleinen Flächen zu speichern, dass sie praktisch verschwinden. Was Anders Kristensen und sein Team von der Technischen Universität Dänemark hier entwickelt haben, ist eine ziemlich raffinierte Anwendung der Nanoplasmonik für neuartige Laserdrucker.
Fotos in Magazinen werden gewöhnlich mit einer Auflösung von 300 Punkten pro Inch gedruckt. Dagegen erreichen die dänischen Physiker mit ihren Plasmonik-Drucker erstaunliche 127.000 Punkte pro Inch. Damit passt ein Farbfoto der Mona Lisa bequem auf ein Pixel eines iPhone-Displays. Und dieser Artikel hätte auf der Fläche eines Haarquerschnitts gleich mehrfach Platz. Gedruckt wird mit einer Geschwindigkeit von einer Nanosekunde (Milliardstel Sekunde) pro Pixel.
Mit diesen Verfahren, sagt Anders Kristensen, lassen sich Daten speichern, die für das bloße Auge unsichtbar würden, ideal etwa "für Seriennummern, Barcodes und andere Informationen“. Die Technologie eigne sich auch zur Fälschungssicherung, weil solche Labels nur sehr schwer reproduziert werden könnten. "Damit lässt sich leichter feststellen, ob ein Produkt das Original oder eine Kopie ist“, so Kristensen. Die dänischen Forscher hoffen, mit ihrer patentierten Technik eines Tages übliche Farblaserdrucker ersetzen zu können.
Am weitesten treibt die Technik derzeit vielleicht Laura Na Liu von der Universität Heidelberg voran. Spricht die gebürtige Hongkong-Chinesin von "smarter Nanoplasmonik“, meint sie vor allem künstliche Nanomaschinen. Diese haben nicht nur ähnliche Dimensionen wie große Biomoleküle im menschlichen Körper. Sie sollen eines Tages auch ähnlich operieren wie biologische Motoren in Zellen, die sich entlang bestimmter Proteinpfade bewegen. "Wir versuchen zu reproduzieren, was die Natur uns vormacht“, sagt die Physikerin.
Im Labor bewegen sich ihre "plasmonischen Gehmaschinen“ bereits auf molekularen Schienen, die mit linear gezogenen DNA-Molekülen ausgelegt wurden. In Nanometerschritten verschieben sich darauf bis zu zwei Nanostäbchen aus Gold. Die winzigen Gebilde sind gerade mal 35 Nanometer lang und zehn Nanometer dick. "Wir können die Goldstäbchen mit Laserlicht steuern und zugleich in Echtzeit verfolgen“, sagt Na Liu, womöglich ein Schritt zu einer "künstlichen Nanomaschinerie.“ Das Ziel ist die Entwicklung von Werkzeugen für eine künftige Nano-Robotik. Die Lichtsteuerung über die Plasmonik erlaubt es erstmals, Bewegungen von Objekten im Molekülbereich gezielt zu steuern. Das könnte eines Tages Eingriffe bei Zellen für Biologie und Medizin eröffnen.
Obwohl die Forscher zahlreiche Einfälle vorweisen können, entwickeln sich viele Ideen der Nanoplasmonik derzeit langsamer als in den Anfangsjahren. Auch wenn weltweit in vielen Labors und Firmen hart an marktfähigen Produkten gearbeitet wird, hat sich der große Durchbruch, sieht man von kleinen Gebrauchsartikeln wie dem Schwangerschaftstest ab, noch nicht eingestellt. Woran liegt das?
Fast immer durchlaufen neue Forschungsgebiete zuerst eine Phase des Enthusiasmus, in der vieles möglich erscheint, auch Fantastisches. Später erst tauchen die harten Probleme und die Mühen der Ebene auf. Die Nanoplasmonik scheint da keine Ausnahme zu bilden. Ortwin Hess gibt zu bedenken: "Das Gebiet ist erwachsen geworden. Wir wissen heute viel genauer, was möglich ist und wo die Träume und Erwartungen vielleicht etwas zu hoch gesteckt waren. Lasst uns eine Fahrt zum Mars planen. Wenn wir’s dann zum Mond schaffen - auch nicht schlecht.“