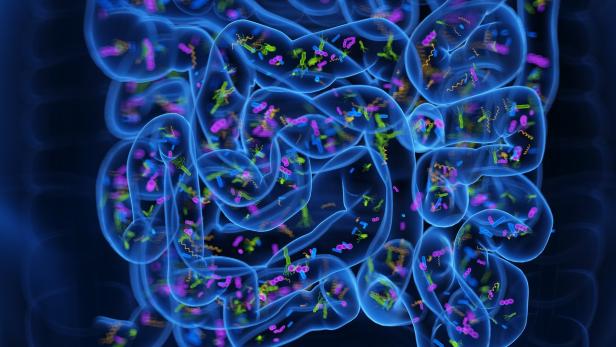Mikrobiologe Alexander Loy
„Es gibt bei fast allen Krankheiten einen Zusammenhang mit dem Mikrobiom.“
Hielt man Bakterien früher vor allem für schädliche Eindringlinge, die Krankheiten verursachen, ist das Bild heute viel differenzierter. Der Mensch koexistiert mit einem riesigen Zoo an Mikroorganismen und wäre ohne seine winzigen Mitbewohner gar nicht lebensfähig. Wir kommen steril zur Welt, werden jedoch schon in den ersten Lebenswochen besiedelt, durch die Geburt, Ernährung und die Umwelt. Nach zwei bis drei Jahren hat jeder Mensch sein individuelles Mikrobiom entwickelt, im Darm genauso wie auf der Haut und im Mund.
Hunderte Spezies von Mikroben leben auf und in uns. Die Zahl ihrer Zellen übersteigt sogar jene unserer etwa 30 Billionen Körperzellen, und die Zahl ihrer Gene ist in Summe um ein Vielfaches höher als die der humanen Gene. Allein auf der Haut siedeln mehr Mikroorganismen als Menschen auf dem Planeten. Und immer mehr Studien belegen, dass die unsichtbaren Untermieter den Menschen gesund erhalten – und andererseits, wenn deren Gleichgewicht aus dem Tritt gerät, an zahlreichen Krankheiten beteiligt sind – solchen des Darms ebenso wie an Krebs, Immunleiden und neurodegenerativen Erkrankungen. „Die Bedeutung der Mikroorganismen ist nicht mehr wegzudenken“, sagt Alexander Loy.
Die Achse zwischen Mikrobiom und Schmerz ist das jüngste Kapitel dieses Forschungszweiges. Und es ist hoch relevant. Denn chronische Schmerzen entziehen sich oft einer wirksamen Behandlung. Während Entstehung und Funktion akuter Schmerzen nach einer Verletzung gut verstanden sind, ist längst nicht restlos geklärt, warum Schmerzen mitunter auch dann bleiben, wenn vom Auslöser längst keine Spur mehr vorhanden ist – oder überhaupt nie eine Ursache gefunden werden kann. Viele Menschen absolvieren eine Vielzahl von Diagnosen, die allesamt keine brauchbare Erklärung liefern. Und während ihnen Schmerzen den Schlaf rauben und die Leistungsfähigkeit einschränken, sagen ihnen Ärzte regelmäßig, dass ihnen nichts fehlt.
Am Beginn der Forschung
Die Frage, welche Rolle das Mikrobiom dabei im Detail spielen könnte, steht noch am Beginn ihrer Untersuchung. Es seien gerade die ersten Schritte getan, erläutert der israelische Schmerzforscher Amir Minerbi in einer Übersichtsarbeit zum Thema. Dabei sei die Evidenz, je nach Schmerzform, unterschiedlich solide. Mitunter könne man bereits kausale Zusammenhänge nachweisen und Symptome mit konkreten Bakterien in Verbindung bringen. Bei manchen Zuständen dagegen ließen sich nur Assoziationen finden: das gleichzeitige Auftreten von chronischem Schmerz und Auffälligkeiten in der Mikrobengemeinschaft. In solchen Fällen kann man nicht beantworten, welcher Faktor den anderen verursacht – oder ob ein dritter Mechanismus im Spiel ist, der beide bedingt. In einigen Fällen wurden die Einflüsse auf Schmerzerkrankungen an Patientengruppen studiert, in anderen nur in Tiermodellen, die längst nicht auf Menschen übertragbar sein müssen.
Dennoch liegen bei manchen Symptombildern bereits schlüssige Hinweise vor, wie Mikrobiom und chronischer Schmerz korrelieren. Relativ naheliegend ist der Einfluss beim Reizdarmsyndrom, das Betroffene mit so lästigen wie diffusen Darmbeschwerden quält. Hier konnten Zusammenhänge zu einer reduzierten Menge nützlicher Darmbakterien aufgedeckt werden, darunter Bifidobakterien und Spezies der Gattung Faecalibacterium. Gleichzeitig war das Vorkommen verschiedener Enterobakterien erhöht. Kritische Verschiebungen der Mikrobengemeinschaft konnten auch bei Patienten mit chronischen Beckenschmerzen festgestellt werden.
Zusammenhang mit Neuropathie, Migräne und Fibromyalgie
Untersucht ist weiters, wenn auch vor allem im Tiermodell, der Bereich neuropathischer Schmerzen. Ein häufiges Beispiel dafür sind Schmerzen, Missempfindungen oder Taubheit in den Gliedmaßen, häufig dann, wenn der Ischiasnerv bedrängt ist, etwa nach Bandscheibenvorfällen. Fallweise bleiben die Probleme über Jahre oder überhaupt dauerhaft, selbst wenn der Auslöser längst abgeheilt ist. In Versuchen mit Ratten mit eingeschnürtem Ischiasnerv ließen sich, anders als bei einer Kontrollgruppe, signifikante Veränderungen der Mikrobengemeinschaft ermitteln. Besonders fehlten den leidenden Tieren Bakterien, die den Stoff Butyrat produzieren – Buttersäure. Vergleichsstudien an humanen Schmerzpatienten fanden einen ähnlichen Mangel butyratproduzierender Bakterien.
Aufschlussreiche Studien liegen auch zu Migräne vor. Für eine Arbeit wurden 25 Zwillingspaare beobachtet, wobei jeweils ein Zwilling an Migräne litt. Es zeigten sich auffällige Unterschiede bei drei Mikrobenarten, wobei die Menge dieser Mikroorganismen bei Migränepatienten stets erheblich reduziert war.
Die Darm-Hirn-Achse
Schließlich erkundeten Forschende den Einfluss des Mikrobioms bei jenen gravierenden Krankheitsbildern, die mit dauerhaft quälendem Schmerz in mehreren Körperregionen einhergehen: bei Fibromyalgie sowie beim sogenannten Ganzkörperschmerz, der in der Regel Regionen des Rückens, Arme und Beine betrifft. Die Resultate waren wieder ähnlich: Es ließen sich eindeutige Unterschiede in der Mikrobenkomposition zwischen leidgeplagten und schmerzfreien Personen dokumentieren. Minerbi nennt die bisher aufgespürten Abweichungen in den Mikrobiomen von Gesunden und Patienten eine „robuste Assoziation“.
Man könnte der Reihe nach all jene Mikrobenstämme aufzählen, die Forschende im Blutserum oder in den Ausscheidungen von Schmerzpatientinnen und -patienten untersuchten, doch das Muster war stets ähnlich: Es ließen sich wiederholt deutliche Abweichungen in Bezug auf die Häufigkeit bestimmter Mikroorganismen feststellen. Verbunden damit schwankten auch Art und Menge der Stoffwechselprodukte, die all die Bakterien erzeugen.
Wesentlich sind beispielsweise kurzkettige Fettsäuren, die im Darm in großen Mengen als Folge von Fermentationsprozessen entstehen. „Diese Metabolite entstehen, wenn Bakterien Energiestoffwechsel betreiben“, erklärt Mikrobiomforscher Loy. Minerbi streicht deren Bedeutung bei vielen Schmerzleiden hervor. Der Einfluss der verschiedenen Metabolite lässt sich vermutlich damit erklären, dass manche auch als Neurotransmitter fungieren können: als Botenstoffe oder Vorstufen dafür, die Nachrichten zwischen Nerven des Darms, des Rückenmarks und des Gehirns austauschen – und somit jene Datenautobahn beliefern, die man Darm-Hirn-Achse nennt. So könnte die Tätigkeit von Darmbakterien daran mitwirken, Schmerzsignale im Gehirn hervorzurufen.
Relevant dürften weiters Substanzen sein, die Entzündungen auslösen oder befördern und auf diesem Wege ins Schmerzgeschehen eingreifen. Dazu zählen etwa Lipopolysaccharide, Zellbestandteile bestimmter Bakterien, die in erhöhter Konzentration bei Patienten mit neuropathischen Schmerzen und solchen mit chronischer Erschöpfung identifiziert wurden.
Ein dunkles Universum
Welche Lehren können von Schmerzen gepeinigte Personen aus diesem Wissen ziehen? Vorerst leider noch wenige. Zwar seien die wichtigsten Großgruppen von Mikroorganismen und einige ihrer Stoffwechselprodukte, die das Mikrobiom bilden, weitgehend verstanden, so Loy, doch in seiner Gesamtheit sei es längst nicht erfasst. Besonders erstaunlich sei, „wie wenig man darüber weiß, wie die Mikroorganismen mit Substanzen aus der Nahrung interagieren und welche Metaboliten sie zusätzlich zu den bereits bekannten produzieren“. Und nicht einmal das gesamte Genom unserer Mikrobenwelt sei kartiert, Schätzungen zufolge ist gerade ein Drittel der Gene des Mikrobioms entschlüsselt.
So lasse sich, trotz aller überzeugenden Erkenntnisse bei einzelnen Krankheitsbildern, auch nicht sagen, wie ein gesundes Mikrobiom in seiner Gesamtheit überhaupt aussieht. Entsprechend sinnlos seien auch all jene meist im Internet angebotenen Schnelltests des Mikrobioms, die nach einmaliger Analyse Aufschluss über krankhaftes Geschehen und dazu passende Abhilfe versprechen. „In Zukunft wird es aber sicher Therapien und Diäten auf Basis von Mikrobiomanalysen geben“, meint Loy. „Das zeigen schon heute vielversprechende Grundlagenstudien.“
Bis dahin lässt sich immerhin auf eine Ernährung achten, die ein möglichst buntes, vielfältiges Mikrobiom hervorbringt. Die Zutaten klingen wenig spektakulär, erfüllen aber erwiesenermaßen ihren Zweck: wenig sogenannte Western Diet mit einem hohen Anteil an tierischem Fett, Schweinefleisch und verarbeiteten Lebensmitteln, stattdessen viel Fisch, ungesättigte Fette wie etwa Olivenöl sowie Obst und Gemüse. Gerade Ballaststoffe fördern die Bildung jener kurzkettigen Fettsäuren, die Entzündungen hemmen – und die den jüngsten Studien zufolge bei vielen Schmerzleiden eine wichtige Rolle spielen.