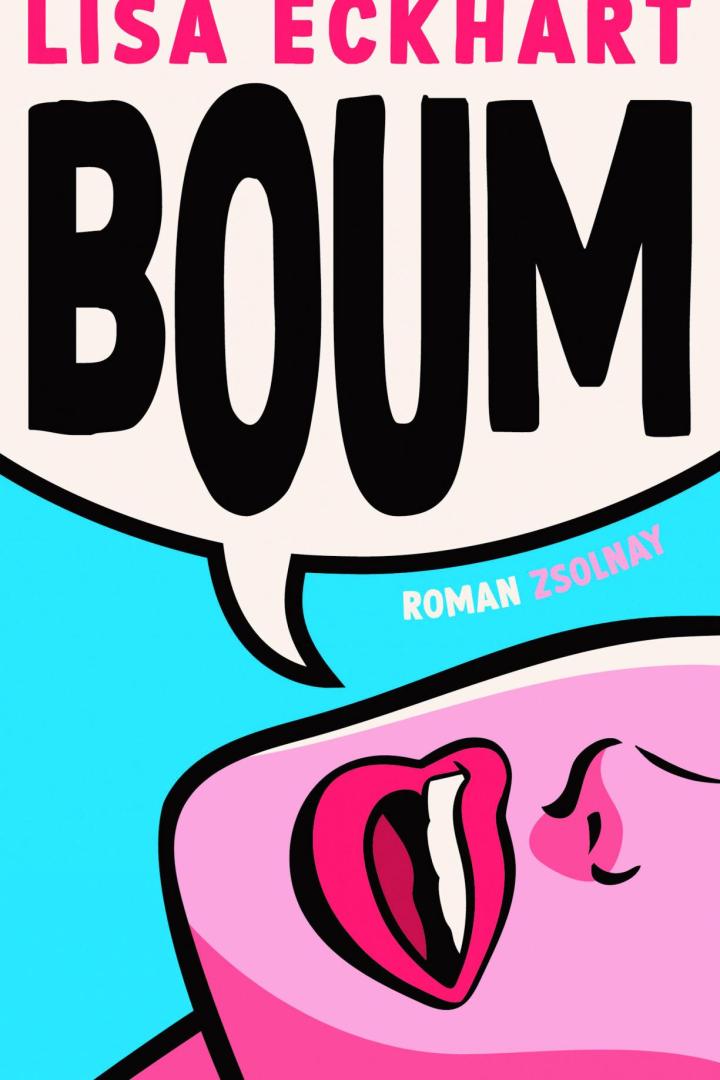In Ihrem Roman werden Frauen, die als Models arbeiten möchten, von ihrer Agentur in die Prostitution getrieben. Das sind wohl eher „Laster“, die auf Männer wie Harvey Weinstein oder Jeffrey Epstein zugeschnitten sind.
Eckhart
Ausbeutung ist es fraglos. Aber es ist doch teilweise auch Lust dabei. Manch einer, der sich da peitschen lässt, tut es gern und freiwillig.
Sie schreiben auch, Sex sei die beste Methode, um einander aus dem Weg zu gehen.
Eckhart
Das wird wohl niemand leugnen: Sex ist einfacher, als einen Dialog zu führen. Oder eine Streitigkeit mühsam rhetorisch auszutragen.
Sie hatten angekündigt, Ihr Buch würde um einen weißen alten Mann kreisen. Warum ist es nun doch eine junge weiße Frau geworden?
Eckhart
Nach meinem Debüt „Omama“ gab es mehrere Buchprojekte. Einige wurden verworfen, andere aufgeschoben. Der alte weiße Mann muss warten, über ihn wurde schon zur Genüge diskutiert. Auch in meinem nächsten Buch wird es eher um alte Frauen gehen.
Das klingt kämpferisch. Würden Sie sich eine Feministin nennen?
Eckhart
Der Vorteil von Ruhm ist, dass ich mich nicht betiteln muss, weil das andere für mich übernehmen – manchmal schmeichelhaft, manchmal nicht. Deshalb würde ich das Werk für sich sprechen lassen. Wenn ich als naiver Beobachter von außen auf mein Werk schaue, würde ich es sogar als ziemlich feministisch einordnen.
Ihre Haltung ist also: Ihr könnt auf mich projizieren, was ihr wollt. Es schadet meiner Karriere ohnehin nicht?
Eckhart
Ich behaupte nicht, dass es mir nicht schadet. Aber man ist solchen Projektionen ohnehin ausgesetzt. Idealerweise kann man seinen Spaß daran haben, aber man sollte sich davon nicht abhängig
machen. Ich glaube ja bekanntlich nicht an diesen wahrhaftigen Kern, der missverstanden werden könnte. Ich sehe mich als Amalgam aus eigenen und fremden Lügen.
Was ist die Kunstfigur Lisa Eckhart? Manchmal hat man das Gefühl, es handelt sich um eine distinguierte ältere Dame aus Döbling, die traurig ist, dass sie Sebastian Kurz nicht mehr wählen darf, die Identitätspolitik so nervig findet, dass sie diese am liebsten canceln würde. Wenn sie Cancel Culture nicht ebenfalls verachtete.
Eckhart
Das fände ich schon heillos fehlinterpretiert. Ich weiß nicht, wie dieses Bild entstehen kann, wenn man sich meine Programme näher anschaut. Aber wie gesagt: Ich kann nichts für die Interpretationskunst der Leute.
In Ihrem aktuellen Roman, aber auch in Ihren Kabarettprogrammen tauchen stark veraltete bis verklemmt-antiquierte Wörter wie „Weib“, „Dirne“, „Gemächt“ oder „Analferkeleien“ auf. Der Schluss liegt doch nahe, dass da eine konservative Tugendhüterin spricht.
Eckhart
Es gibt leider sehr viele Wörter, die heute nicht mehr verwendet werden. Es ist eine Kuriosität, dass besonders Leute, die sich sehr sprachsensibel wähnen, die Sprache mit Füßen treten. Ich finde grau und beschränkt, wie wir mit Sprache spielen. Auch ein bisschen trostlos. Deshalb klaube ich aus allen Epochen etwas heraus, um es dann neu zusammenzusetzen.
Manchmal sterben Wörter aber auch völlig zu Recht aus, weil sie lebensfremd sind oder als verletzend wahrgenommen werden.
Eckhart
Aber die Realitäten dahinter verschwinden ja nicht, nur weil man die Wörter auslöscht. Das sehe ich analog zu dem, was mit den Obdachlosen passiert. Es nennt sich defensive Architektur, wenn Bänke so konstruiert werden, dass kein Obdachloser mehr darauf schlafen kann. Und im besten Fall glauben die Normalsterblichen, das sei Kunst. So scheint mir das auch mit den Wörtern zu sein: Man schafft neue, kunstvolle Wörter, aber die Realität dahinter, der Obdachlose, verschwindet ja nicht. Er wird nur nicht mehr gesehen.
Es gibt aber auch das Gegenteil: Marginalisierte Gruppen, die bestimmte Begriffe einfordern, um besser gesehen zu werden. Ist das bloß Political Correctness oder auch für Sie in Ordnung?
Eckhart
Alles völlig legitim. Aber da reden wir über Alltagssprache. Man darf Kunst und Alltag nicht verwechseln.
Stehen Ihre Literatur und Ihr Kabarett denn auf derselben Stufe? Sehen Sie beides als Sprachkunstwerke?
Eckhart
Würde ich schon sagen. Wenngleich man in der Literatur gefeiter ist vor Anfeindungen. Auch der Grantigste muss sich eingestehen, dass es Figuren sind, die da sprechen. Dass die dann teilweise sogar rassistisch reden. Sonst könnte ich ja die Welt nicht abbilden.
Die Literatur ist also ein Safe Space, in dem man alle Freiheiten hat? Auf der Bühne ist man angreifbarer, vor allem, wenn man keine eindeutige Kunstfigur ist.
Eckhart
Ich sage mittlerweile ja nicht einmal mehr, dass ich keine Kunstfigur bin. Sobald ich Kunst
mache, bin ich eine Kunstfigur. Diejenigen, die sich besonders authentisch fühlen, sind doch meist die Künstlichsten von allen.
Ist Ihre Weiblichkeit nur eine Gender-Performance, frei nach der Theoretikerin Judith Butler?
Eckhart
Absolut. Ich fand diesen Gedanken, unser Geschlecht als Rolle zu begreifen, immer sehr charmant. Auch dass in der Maskerade ein subversives Potenzial liegt. Natürlich legt die Biologie erst einmal etwas fest, gegen das man hartnäckig ankämpfen muss, wenn man es sich anders wünscht. Aber es steckt für mich eine gewisse Freiheit darin, mich nicht als ein determiniertes Wesen zu sehen.
Sie wollten in der Pubertät eine Zeit lang als Bub angesprochen werden. Sind Sie genderfluid?
Eckhart
Auf jeden Fall. An manchen Tagen fühle ich mich auch völlig ohne Geschlecht. Fluidität war für mich immer ein großes Versprechen – nicht nur, was Geschlecht betrifft. Ich glaube an ein schwammiges Ich, auf das man nicht von Geburt an festgelegt ist. Ich fände es schade, wenn man das Rädchen zurückdrehen wollte zu einem sturen Essentialismus, der genau zu wissen glaubt, was Männer und was Frauen sind. Aber auch diesen Glauben möchte ich niemandem nehmen.
Sie sind also keine „Terf“ wie Alice Schwarzer, die behauptet, dass Trans bloß eine Mode sei? Die Trans-Frauen das Recht abspricht, eine Frau zu sein?
Eckhart
Ehrlich gesagt, das ist nicht mein Kampf. Ich bin in erster Linie für die Kunst zuständig und die Diskriminierung, die sie erfahren muss. Ich kann nicht an allen Fronten gleichzeitig tanzen.
Sie haben Ihre Diplomarbeit über Weiblichkeit im Nationalsozialismus anhand der Tagebücher von Joseph Goebbels verfasst. Warum wurde diese an Ihrer Universität abgelehnt?
Eckhart
Ich hatte zu jener Zeit einen schweren Fall von akademischer Verliebtheit in den Kulturtheoretiker Klaus Theweleit. „Männerphantasien“ war eines der ersten Werke, in dem ich mit Gender in Berührung kam, obwohl es damals noch nicht so hieß. Diese Körper, die sich als Männerpanzer selbst konstruieren, das war für mich sehr augenöffnend. Aber ich liebte auch das unfassbar Verspielte der Theweleit’schen Sprache. Meine Professoren meinten aber völlig zu Recht, meine Diplomarbeit sei ein unwissenschaftliches Monstrum. Ich solle nicht über meine Verhältnisse arbeiten.
Wie war denn Goebbels’ Frauenbild?
Eckhart
eine fünfbändigen Tagebücher sind eine relativ dröge Angelegenheit. Letztendlich ging es ihm weniger um die Weiber als dauernd nur um seinen Hund. Anregender fand ich da die Lektüre von Otto Weininger: ein herrlicher Quatsch, an dem man sich erheitern kann. Ich habe sogar eine Pointe aus dessen „Geschlecht und Charakter“ gestohlen: „Je länger das Haar, desto kürzer der Verstand.“
Reden wir über Cancel Culture. Als Sie bei einem Hamburger Literaturfestival 2020 ausgeladen wurden, gab es medial große Aufmerksamkeit – und unzählige neue Einladungen. In großem Stil gecancelt wurden Sie nicht.
Eckhart
Ich hätte mir diese Aufmerksamkeit halt gern selbst erarbeitet. Meine Angreifer wussten, ich war nicht zu canceln. So konnte man sinnbefreit auf mich einschlagen und musste sich nachher nicht schlecht fühlen. Man wurde nicht zum Täter, weil man es ja ohnehin nicht geschafft hatte, jemanden zu canceln. Es wäre einfacher gewesen, weniger bekannte Künstler anzugreifen und ihnen wirklich das Genick zu brechen. Das macht man aber nicht, weil man scheitern muss, um unschuldig zu bleiben.
Kaum jemand hatte langfristig Schaden; der Schauspieler Johnny Depp verdient nach dem Prozess gegen Amber Heard besser als je zuvor. Ist scheinbares „Canceln“ nicht oft nur der Aufruf, über Missstände zu diskutieren?
Eckhart
Diskussion ist allerdings ein antiquierter Begriff. Wenn ein Mob, der auf ungerechtfertigte Weise Zugang zur Weltöffentlichkeit bekommen hat, auf unterstem Niveau seinen Unmut kundtut, hat das mit Diskussion nichts zu tun. Diese Leute haben nur eine Monologbereitschaft, das ist kein verschämtes Andeuten von Unbehagen. Das sind meist Menschen, die nur auf Zerstörung aus sind. Deshalb sehe ich da eher einen Verfall von Zivilisation als einen Fortschritt.
Sie sprechen Shitstorms in sozialen Medien an. Abgesehen von unkontrolliertem Hass gibt es aber auch kluge Stimmen im Internet. Ein Blick in die Geschichte zeigt zudem: Frauenrechte wurden nicht erkämpft, weil man nett gebeten hatte. Da musste man auch übers Ziel hinausschießen und mit Gegenwind rechnen.
Eckhart
Ja, nur waren diese Forderungen nicht ungerechtfertigt. Jetzt auf eine Welt einzuschlagen, in der Frauen sehr viel erreicht haben, und zu behaupten, das Patriarchat sei so schlimm wie eh und je, finde ich ein bisschen undankbar. Das Patriarchat ist doch, gelinde gesagt, sehr angeschlagen. Es siecht dahin.
Sie rechnen also mit einer feministischen Zukunft?
Eckhart
Ich sehe einen geschlechtslosen User, der mit der analogen Welt nicht mehr viel zu tun hat. Die wird dann hoffentlich von den Obdachlosen zurückerobert, während sich der wohlhabende Rest der Welt selbst ins Digitale abschiebt. Ich habe keine demokratischen Illusionen, was das Internet betrifft. Wer an seiner mentalen Gesundheit hängt, sollte sich da schleunigst rausbegeben. Und da klinge ich gern … Wie haben Sie gesagt? Wie eine Döblingerin?
Wie eine Gräfin, die sich luxuriös auf ihr Gestüt zurückzieht.
Eckhart
Sehr gerne. Ich glaube, dass sich mir in den nächsten Jahrzehnten viele anschließen wollen, aber es wird zu spät sein. Wenn sich Prominente ins Internet begeben, finde ich das unangemessen. Das ist, als würde sich die Queen in den Speakers’ Corner stellen.
Sie sind in den sozialen Medien nicht aktiv. Trotzdem findet man auf Instagram ein Video von Ihnen, das Sie mit Ihrem Baby zeigt.
Eckhart
Das ist ein Fan-Account. Das Video habe ich an den Verlag geschickt als Werbung für mein Buch. Das Internet ist eben nicht kontrollierbar.
Nervt es Sie, wenn Sie auf der Straße angesprochen werden?
Eckhart
Im Gegenteil. Mit Ausnahme von Salman Rushdie wird niemand ernsthaft auf der Straße angepöbelt. Ich erlebe nur zuckersüßes Wohlwollen bis hin zu Umarmungen.
Gehen Sie stets präsentabel in die Außenwelt oder laufen Sie auch mal in der Jogginghose herum?
Eckhart
Natürlich gibt es mich auch inszeniert verlottert. Halt in Pyjamahose. Viele meiner Fans würden eine Jogginghose als Verrat empfinden, weil ich doch predige, absolut keinen Sport zu machen.
Würden Sie das N-Wort gebrauchen?
Eckhart
Hat sich jetzt so nicht ergeben.
Wie meinen Sie das?
Eckhart
Wir wissen, wie albern diese Frage ist, die rein auf Krawall aus ist. Und das ist immer noch meine Aufgabe.
Sie könnten ja einfach sagen: Nein, mir ist Respekt wichtig.
Eckhart
Ja, aber ich finde solche Fragen beleidigend.
Sie legen großen Wert auf Höflichkeit und Distanz, wollen per Sie angesprochen werden. Da ist es doch angebracht, zu fragen, wie es mit Ihrer Höflichkeit aussieht.
Eckhart
Ich bin nicht korrekt, aber ich bin höflich. Manche meinen, allein der Begriff des Unkorrekten sei schon unhöflich – und damit hat man eigentlich schon seine Antwort.
Was unterscheidet Höflichkeit von Korrektheit?
Eckhart
Höflichkeit ist für mich überlegen, weil sie nicht mit strengen Regeln operiert. Sie ist kein Raster, sondern reagiert auf Menschen. Sie ist komplex. Der britische Comedian Sacha Baron Cohen hat einmal einen Vegetarier gefragt hat, ob er ein Huhn essen würde, um ein anderes Huhn zu retten. In diesem Sinne: Würden Sie das N-Wort nennen, wenn Sie damit ein Leben retten könnten?
Das klingt schon wahnsinnig konstruiert.
Eckhart
Ja, natürlich. Aber mein Punkt ist: Ich gehe auf mein Gegenüber ein und analysiere: Wie funktioniert dieser Mensch? Welche Art von Humor hat er? Wie weit kann ich gehen? Es ist für mich eine Form von Diversität, dass wir nicht alle Menschen gleich behandeln und glauben, dass man mit ihnen allen die gleichen Diskurse pflegen kann. Das lässt ein bisschen Spiel und Spaß übrig.
Aber man hat doch eine bestimmte Haltung zu Dingen, die man nicht einfach ablegt, nur weil das Gegenüber anders ist. Zugespitzt formuliert: Wenn ich mit einem Nazi am Wirtshaustisch sitze, erzähle ich doch auch keine rassistischen Witze.
Eckhart
Zu tun, was andere erwarten, ist nicht höflich, sondern charakterlos. Aber es ist erstaunlich, wie oft dieser Wirtshaustisch genannt wird, der ohnehin im Aussterben begriffen ist. Er gehört zu den linken Schreckgespenstern, auf der anderen Seite ist es eben „der Ausländer“.
Ich meine auch die virtuellen Wirtshaustische.
Eckhart
Die gibt es zweifelsohne. Aber ob da noch Witze erzählt werden?
Wir haben noch gar nicht übers Kabarett gesprochen. Wollen Sie wirklich 2023 aufhören?
Eckhart
Es wird mein letztes Programm in Deutschland und Österreich sein. Der Inhalt ist eine Nummer, die sich zum Programm ausgeweitet hat: Ich vereinige Ostdeutschland und Österreich – und herrsche kaiserlich-kommunistisch als Kaiserin Stasi die
Erste. Nach diesem Abschiedsprogramm gehe ich ins französische Exil. Ich plane, länger in Paris zu leben.
Wenn Sie auf Ihre bisherige Kabarett-Karriere zurückblicken: Gibt es etwas, das Sie anders machen würden?
Eckhart
Nein. Ich bin immer wieder erstaunt, wofür sich Leute entschuldigen. Wieso denken die nicht vorher nach? Die Wörter plumpsen aus ihren Mündern, wirklich sprechen kann man es ja nicht mehr nennen. Das ist diesem elenden Podcast-Geschwafel geschuldet, das die Leute hören. Ich arbeite an meinen Texten, sie sind wohldurchdacht. Das mag nicht jedem gefallen, aber ich bin im Reinen und muss mich deshalb nicht im Nachhinein entschuldigen. Das Kabarett ist ein Beruf, der idealerweise ungemütlich ist.
Verändert man sich nicht auch im Lauf der Zeit?
Eckhart
Freilich, ganz am Anfang waren ein paar Reime unrein. Es sind ästhetische Schnitzer, die ich bedauere.
2018 hagelte es Kritik nach einem WDR-Auftritt, bei dem Sie unter anderem gesagt hatten: Den Juden Reparationen zu zahlen, das sei wie Dietrich Mateschitz ein Red Bull auszugeben.
Eckhart
Ich habe ein so breites Werk, und alle machen es sich so einfach, immer wieder darauf zurückzukommen.
Mich interessiert aber gerade die zeitliche Distanz. Sie trafen in vielen Diskussionsrunden auch auf Antisemitismus-Experten. Es könnte doch sein, dass Sie inzwischen verstanden haben, wie problematisch es ist, derart abgegriffene Klischees aufzuwärmen wie jenes, dass alle Juden reich wären. Das ist statistisch eindeutig widerlegt, schürt in den Köpfen aber nach wie vor den Hass.
Eckhart
Man kann im Kabarett nicht ohne Klischees arbeiten. Mein Ansatz ist es, Klischees aufzugreifen und zu brechen.
Woran lag bei obigem Zitat denn die Brechung?
Eckhart
Ich diskutiere nicht über eine Nummer, die vier Jahre alt ist. Ich habe diesen Eitelkeitsanspruch, mich nicht dauernd zu wiederholen.
Sie haben 2021 einen weiteren Witz gemacht: Die Juden seien den Frauen in Sachen Humor „um zwei Nasenlängen voraus“. Was ist das? Lust an der Provokation?
Eckhart
Es darf sich keiner die Rosinen aus meinem Werk herauspicken. Es kommt darin niemand zu kurz, das wäre tatsächlich diskriminierend. Ich habe alle Ethnien, Geschlechter und Religionen durch. Ich habe jetzt auch die Skandinavier reingenommen, damit kein Rassismusvorwurf kommt.
Sind Sie manchmal überrascht, wo die Leute lachen?
Eckhart
Bei Lesungen werde ich oft gefragt, was meine Vorbilder sind. Dann sage ich immer, dass ich den Humor im Werk von Elfriede Jelinek faszinierend finde. Da lachen dann immer einige, weil sie nicht verstehen, wie lustig Jelinek ist. Aber ansonsten sind wir uns meist einig.
Ist Schreiben an einem Roman freier, weil man keine Pointen setzen muss?
Eckhart
Wahrscheinlich hätte man mir bei „Omama“ noch mehr auf die Finger klopfen müssen. Kein Mensch erträgt eine Pointe nach der anderen in einem Roman.
Haben Sie das Gefühl, auch privat Pointen abliefern zu müssen?
Eckhart
Die 90 Minuten auf der Bühne reichen mir völlig. Das ist auch einer zunehmenden Erfolgsarroganz geschuldet: Ich werde erst ab einer gewissen Zuschauerzahl warm. Auf Dinnerpartys gebe ich mich am liebsten taubstumm, weil ich nicht gewillt bin, für zehn nicht zahlende Gäste Witze zu liefern. Mir kommt auch vor, viele sind dafür dankbar. Nichts ist schlimmer als ein Kabarettist, der nicht aufhört, sein Programm vorzuspielen. Der in einer Humorschleife gefangen ist.
Sie sind also eine Mischung aus Höflichkeit und Arroganz?
Eckhart
Das bedingt sich ja. Höflichkeit ist ein alternierendes Spiel. Ich werfe mich vor Menschen in den Staub. Und wenn sie das anschließend auch für mich tun, ist es nur höflich, aufrecht zu stehen und nicht bescheiden vor ihnen zu lümmeln.