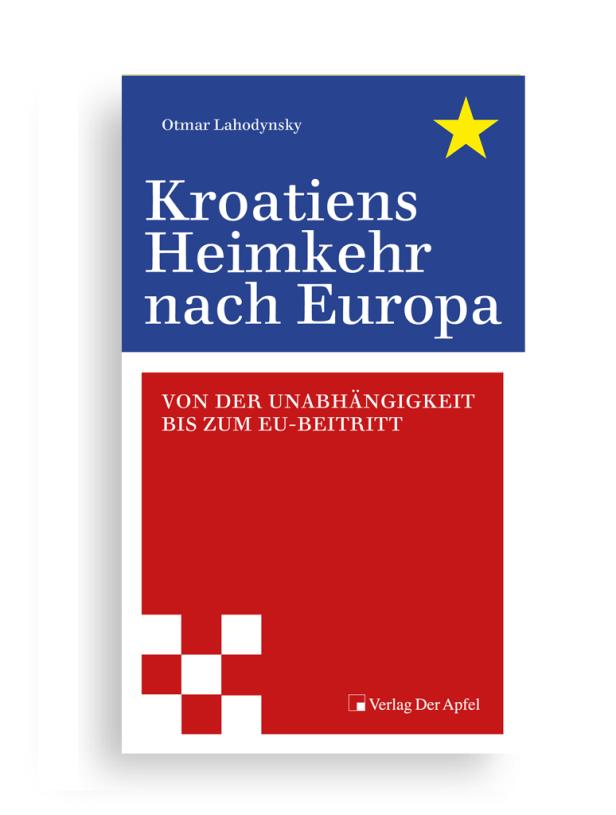Wie Österreich den Kroaten den Weg zur Unabhängigkeit ebnete
Es ist eine hochrangige Liste an ehemaligen Spitzenpolitikern, mit denen der langjährige profil-Journalist Otmar Lahodynsky für sein Buch "Kroatiens Heimkehr nach Europa" sprach: Darin kommt der einst Kroatien-skeptische Ex-SPÖ-Bundeskanzler Franz Vranitzky ebenso zu Wort wie der kroatische Ex-Außenminister Mate Granić.
Das Buch ist eine zeitgeschichtliche Spurensuche über Kroatien. Anhand von Akten aus dem Staatsarchiv zeichnet Lahodynsky den Weg von der Unabhängigkeit bis zum EU-Beitritt mit zahlreichen Anekdoten nach. Zu Wort kommen politische Zeitzeugen der ersten Stunde bis zum unlängst erfolgten Schengen- und Euro-Beitritt.
Ich vertrat die Auffassung, dass ein Alleingang Österreichs nichts bringt und uns womöglich niemand nachreitet.
Der Ex-SPÖ-Kanzler wollte Kroatien zunächst nicht anerkennen
Weite Strecken sind der Frage der Anerkennung Kroatiens nach dem Zerfall Jugoslawiens gewidmet. Der damalige Außenminister Alois Mock (ÖVP) rief die Europäische Gemeinschaft (EG) bereits frühzeitig zum Eingreifen auf, was auf Kritik stieß. Demgegenüber überwogen in der SPÖ die Argumente für eine Beibehaltung Jugoslawiens, Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) wandte sich zunächst gegen eine Anerkennung Sloweniens und Kroatiens. "Ich vertrat die Auffassung, dass ein Alleingang Österreichs nichts bringt und uns womöglich niemand nachreitet", schildert der Ex-Kanzler in dem Buch.
In der EG waren vor allem Frankreich und Großbritannien für die Erhaltung Jugoslawiens. Erst der Fall Vukovars und Kriegsverbrechen der jugoslawischen Armee an Zivilisten brachten den Umschwung. Bei einem Außenministerrat am 16./17. Dezember 1991 überzeugte Deutschlands Außenminister Hans-Dietrich Genscher mit Unterstützung von Bundeskanzler Helmut Kohl die EG-Außenminister, Kroatien und Slowenien innerhalb eines Monats anzuerkennen. Österreich legte zeitgleich denselben Termin fest: Am 15. Jänner 1992 folgte die Anerkennung Kroatiens und Sloweniens gemeinsam mit der EG.
Der kroatische Ex-Außenminister Mate Granić erinnert sich in dem Buch Lahodynskys, dass ihm die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher später gesagt habe: "Wenn ich und (der frühere US-Präsident, Anm.) Ronald Reagan 1991 an der Macht gewesen wären, hätten wir Milosević und Belgrad sofort bombardiert, und es hätte keinen Krieg gegeben." Leider habe die Europäische Union lange auf Milosevic gesetzt und völlig falsche Einschätzungen vorgenommen.
Der Europarats-Direktor im französischen Außenministerium, Jacques Blot, hält Österreich in hohem Maße dafür verantwortlich, dass es zum Krieg in Jugoslawien gekommen ist.
Die österreichische Politik wurde dagegen von Frankreich harsch kritisiert. "Der Europarats-Direktor im französischen Außenministerium, Jacques Blot, hält Österreich in hohem Maße dafür verantwortlich, dass es zum Krieg in Jugoslawien gekommen ist", geht aus einer "Notiz" des damaligen Gesandten und späteren Generalsekretärs im Außenministerium, Albert Rohan, vom Juli 1992 hervor. Insbesondere der österreichische Außenminister habe die Auflösung Jugoslawiens "encouragiert". Trotz ihrer Brisanz wurde die Notiz nie weitergeleitet. "Vielleicht wollte Rohan Außenminister Mock, der ja eine besondere persönliche Beziehung mit Frankreich pflegte, nicht unnötig verärgern", die Anerkennung der EG-Staaten war ja bereits vollzogen, mutmaßt der Autor.
Erwartungsgemäß verurteilte Belgrad die Anerkennung der ehemaligen Teilrepubliken. Bitter beklagte Belgrad aber auch, dass Österreich ein Militärflugzeug der jugoslawischen Luftwaffe vom Typ MIG21, mit dem ein fahnenflüchtiger Pilot in Österreich gelandet war, nicht zurückgab. "Wir verwiesen auf unser Gesetz, wonach Rüstungsexporte in Kriegsgebiete verboten sind", erläutert der damalige Verteidigungsminister Werner Fasslabend. Serbische Tageszeitungen spekulierten sogar, dass aus Österreich Waffenlieferungen an Kroatien erfolgt seien und in Tirol muslimische "Terroristen" ausgebildet würden - was von Außen- und Innenministerium in Wien dementiert wurde.
Weniger anekdotenreich, aber mit viel Expertise wird in dem Buch der anschließende mühsame Weg Kroatiens in die Europäische Union dargestellt. Hindernisse waren unter anderem die Zusammenarbeit mit dem Haager Tribunal und der Grenzstreit mit Slowenien. "Leider hat Kroatien einen sehr viel schwierigeren Weg zurückgelegt als andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union", resümiert Granić. Den Antrag auf Mitgliedschaft hatte Zagreb bereits im Februar 2003 gestellt. Die Verhandlungen begannen aber erst 2005, nachdem Chefanklägerin Carla del Ponte die volle Kooperation mit dem Haager Tribunal bestätigt hatte.
Erstmals musste sich ein Beitrittsland in den Verhandlungen dem Kapitel "Justiz und Grundrechte stellen", anders als im Fall von Bulgarien und Rumänien war dafür für Kroatien nach dem Beitritt kein Justiz-Monitoring vorgesehen. Hatte die Regierung den Beitritt schon rund um das Jahr 2007 erwartet, so dauerte es doch bis zum 1. Juli 2013, bis Kroatien als 28. Mitglied der Europäischen Union beitrat. Mitglied der NATO wurde das Land viel schneller, nämlich bereits 2009.
Zehn Jahre nach dem EU-Beitritt wurde für Kroatien ein neues Kapitel der europäischen Integration aufgeschlagen: Das Land wurde am 1. Jänner 2023 Mitglied der Schengen- und der Euro-Zone. Kroatien sei "damit in den innersten Kreis der EU vorgerückt", schreibt Lahodynsky. "Heute sind wir keine Ausländer mehr, wir sind zu Hause", fasst es der amtierende Außenminister Gordan Grlić Radman zusammen.
Lahodynsky zeigt sich als Freund Kroatiens und seiner Menschen, der das Land immer wieder bereist hat. Er spart aber auch die kritischen Aspekte nicht aus. So wird etwa der Nationalismus des ersten Staatspräsidenten Franjo Tudjman ebenso angesprochen wie hochrangige Korruptionsfälle (z.B. die Patria-Affäre und der Fall von Ex-Ministerpräsident Ivo Sanader) sowie nach wie vor bestehende Wirtschaftsprobleme, etwa die hohe Abhängigkeit vom Tourismus.
Viel erfährt der Leser auch über die besonders engen österreichisch-kroatischen Beziehungen: Etwa über die Bedeutung der "Österreichisch-Kroatischen Gesellschaft" als Bindeglied zwischen Wien und Zagreb. Oder dass schon kurz nach Erlangen der staatlichen Eigenständigkeit im Zentrum der kroatischen Hauptstadt eine "Straße der Republik Österreich" neu benannt wurde - eine besondere Auszeichnung, weil andere befreundete Staaten nach ihnen benannte Straßen nur in den Außenbezirken Zagrebs bekommen hatten.
Das Buch
Lahodynsky, Otmar: Kroatiens Heimkehr nach Europa. Von der Unabhängigkeit bis zum EU-Beitritt, Wien, Verlag Der Apfel 2023, ISBN 978-3-85450-010-0