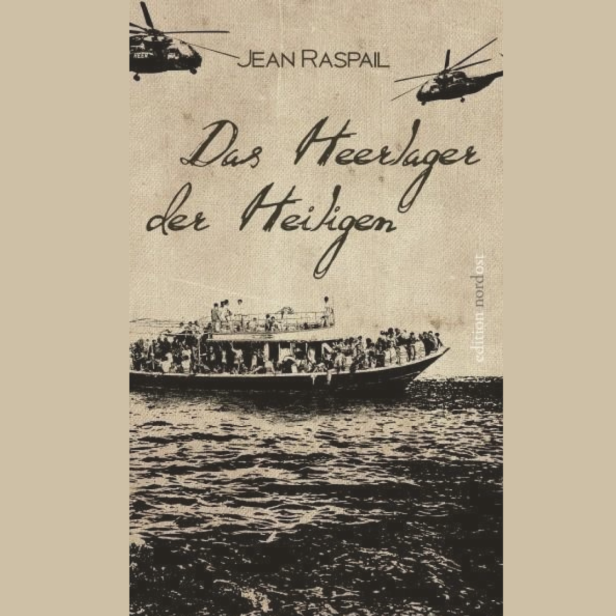Bernhard Pörksen: "Nähe ist ein Mittel zum Zweck. Was aber war noch mal der Zweck?"
Corona, Migration, Ukraine-Krieg: Der Verdacht, dass Medien nicht ausgewogen berichten, begleitet alle großen Debatten. Was ist dran an dem Vorwurf? Und was ist guter Journalismus überhaupt? Medienwissenschafter Bernhard Pörksen lässt sich auf die Streitfrage ein.
Nicht nur der Politik, auch den Medien schlägt generelles Misstrauen entgegen. Welchen Journalismus brauchen wir heute?
Pörksen
Ich antworte als schlecht verkappter Idealist. Nötig ist ein Journalismus des zweiten Gedankens, der, unerschrocken und faktenorientiert, um Aufklärung ringt. Der sich nicht im Hype des Augenblicks verliert, sondern dabei hilft, die Großkrisen der Gegenwart besser zu begreifen, Szenarien der Lösung zu präsentieren. Das heißt: weg von der bloß zeitlich bestimmten Aktualität hin zur existenziellen Relevanz und einer mitfühlenden, diskursorientierten Zukunftsgestaltung. Das wäre das Credo für unsere Zeit, denke ich.
In dem Buch "Die vierte Gewalt" werfen Richard David Precht und Harald Welzer Journalisten vor, sich vor allem an der eigenen Blase zu orientieren. Stichwort: Selbstgleichschaltung. Was ist Ihre Auffassung?
Pörksen
Ich zögere mit einer Antwort, denn die Autoren haben längst jede Menge Kritik und manchmal auch maßlose Attacken kassiert, überdies lobt Precht inzwischen selbst "Talk im Hangar" von ServusTV als Musterbeispiel der ausgewogenen Debatte im Ukraine-Krieg. Für mich ist das einfach nur ein intellektuell unergiebiges Herumstochern im Meinungsnebel, Indiz für den Verlust von Orientierung und Kategorien.
Und doch: Was ist dran an dem Vorwurf?
Pörksen
Empirisch nicht viel. Man sieht hier überdies, dass die gewählte Begrifflichkeit - später sprach man dann abschwächend von der Selbstangleichung des Journalismus - zur rhetorischen Eskalation taugt, die vermeintlich warnend gemeinte Diskursbeschreibung also eigentlich ein Mittel der Diskursverhärtung ist. Zum anderen wird hier, eben das macht den Befund brisant, von linksliberalen Autoren eine Form von pauschaler Journalismus -Kritik gewählt, die man Konsens-Skandalisierung nennen könnte. Man attackiert einen vermeintlich übermächtigen Medienmainstream. Und plädiert für eine nicht näher ausgeführte Vervielfältigung der Perspektiven, für eine größere Stimmenvielfalt, für mehr Ausgewogenheit im Diskurs.
Der Verdacht, dass Medien nicht ausgewogen berichten, wird besonders laut, wenn es um große, strittige Fragen geht -Corona, Migration, Sanktionen gegen Russland. Was wäre darauf eine gute Antwort?
Pörksen
Dreierlei. Zum einen geht es hier um eine empirische Frage. War die Berichterstattung in der Migrations-und Corona-Krise tatsächlich so monolithisch, so undifferenziert? Das trifft so nicht zu. Und mit Blick auf die Ukraine-Krise und die Russland-Sanktionen lagen, als die Autoren ihre Thesen formulierten, noch gar keine ausreichend aussagekräftigen Studien vor. Hier ging man also von gefühlten Realitäten aus – und behauptete, was zunächst erst einmal zu belegen wäre. Zum anderen ist Dissens nicht immer gut und ein Konsens nicht prinzipiell verdächtig.
Die Frage ist: Wie, auf welcher Basis kommt ein Konsens zustande?
Pörksen
Genau. Wird ausreichend offen und ausgeruht debattiert? Irgendwann ist der Streit in der Sache dann vielleicht gut begründet entschieden. Und schließlich ist das Vielfalts- und Ausgewogenheitsplädoyer mitunter einfach eine Chiffre für False-Balance-Propaganda. Eigentlich geht es dann darum, randständige und auch extremistische Positionen im Diskurs zu beheimaten, sie zu adeln.
Je unsicherer und volatiler die Welt, desto größer die Sehnsucht nach Eindeutigkeit und Einfachheit. Müssen Medien da ein Stück weit mitspielen?
Pörksen
Empirisch gesprochen ist das unvermeidlich, wenn auch normativ mitunter zu beklagen. Was mir vorschwebt, ist - um nicht einfach nur mitzumachen im Erregungsspiel - ein Ideal der Berichterstattung, das man Tiefeneinfachheit nennen könnte, komplexitätserhaltende Komplexitätsreduktion. Ein Kunststück eigener Art.
An Themen, die auf sozialen Plattformen wie Twitter oder Facebook für Erregung sorgen - also trenden, wie es so schön heißt -, können klassische Medien mitunter kaum vorbei. Ein Trugschluss?
Pörksen
Nein. Denn hier zeigt sich ein wesentlicher Effekt der Digitalisierung, dem man sich kaum entziehen kann: Publikumsinteressen und gesellschaftliche Erwartungen drücken sich in ganz anderer Direktheit und Unmittelbarkeit aus. Das ist eine zwiespältige Nachricht. Einerseits werden gesellschaftliche Erwartungen so zum unmittelbar erlebbaren Korrektiv; wunderbar, könnte man sagen. Andererseits sieht man eben auch, wie unwahrscheinlich gut banale Aufreger und zum Beispiel sogenannte interspecies love stories -"Tiger kuschelt mit Ziege" - geklickt werden.
Was ist die Folge?
Pörksen
Ein noch unverstandener Kampf zwischen zwei Prinzipien. Auf der einen Seite steht das Diktat der Relevanz, geleitet von der Frage: Was ist wirklich wichtig? Auf der anderen Seite: das Diktat der Interessantheit, orientiert an der Frage: Was funktioniert tatsächlich in einem immer härter werdenden Kampf um Aufmerksamkeit? Viel zu oft erschlägt die Interessantheit die Relevanz.
Öffentlich gewordene Chats, in denen sich ÖVP-Politiker und zwei Chefredakteure ungeniert über Posten und genehme Berichterstattung austauschen, zeigten genau jene Verhaberung, die Medien und Politik mitunter unterstellt wird. Welche Lehre ist daraus zu ziehen?
Pörksen
Diese Lehre ist sehr einfach: Distanz ist wichtig. Und nur mal nebenbei, aber doch ganz grundsätzlich: Es lässt sich in der aktuellen Aufarbeitungsphase ein für die Skandalforschung hoch interessantes Phänomen entdecken, eine Art Möglichkeitsblindheit. Wir alle sind -auch jenseits der fiebrigen Truppe um Sebastian Kurz - blind für die mögliche Zukunft unserer SMS-Botschaften, Chatprotokolle, Mailboxnachrichten, können uns die womöglich beschämenden Kontexte, in denen unsere Daten und Dokumente eines Tages zu uns zurückkehren, schlicht nicht vorstellen. Überall lagern und schmoren also Informationspartikel, die vielleicht übermorgen schon zu handfesten Skandalbeweisen werden.
Aber um den Mächtigen auf die Finger schauen zu können, muss man ihnen auch nahe kommen. Also: Wo ist die rote Linie?
Pörksen
Nähe ist im Journalismus primär ein instrumenteller Wert, ein Mittel zum Zweck. Was aber war noch mal der Zweck? Keineswegs der persönliche Nutzen und der individuelle Vorteil, sondern eine präzisere Beschreibung der Lebenswelten, eine kenntnisreichere Kritik der Mächtigen. Aber erneut: Ich argumentiere hier als melancholischer Idealist vom Spielfeldrand.
Populistische Parteien sind seit mehr als 15 Jahren in Europa im Aufwind. Müssen klassische Medien sich damit abfinden, dass viele Leserinnen und Zuseher nur ihre eigene Position wiederfinden wollen?
Pörksen
Ich sage es mal so: Die Korrektur der allgemein menschlichen Bestätigungssehnsucht wird in den aktuellen Medienumwelten schwieriger. Warum? Die Anzeigenfinanzierung im Journalismus schwächelt. In diesem Jahr wird mehr als die Hälfte aller Werbegelder an nur drei Unternehmen gehen: Google, Meta, Amazon. Das heißt: Das diffuse, ideologisch diverse Massenpublikum -im Verbund mit einer starken Anzeigenfinanzierung lange die tragende Finanzquelle des seriösen Journalismus - wird allmählich zum Stamm treuer Anhänger. Das ist die neue ökonomische Basis vieler Angebote, der Abonnent mit seinen Erwartungen. Die Folge: Publizistische Gesinnungspflege wird in anderer Unmittelbarkeit zum Geschäftsmodell , im Extremfall auch zur ökonomischen Notwendigkeit. Die langfristige Wirkung: Nischenbildung, die Herausbildung medialer Selbstbestätigungsmilieus, Polarisierungseffekte.
Vor 30 Jahren verschwanden die Parteizeitungen. Nun hat jede Partei wieder ein eigenes Medium. Die FPÖ startete in Österreich 2009 mit unzensuriert.at, um ihre politischen Anliegen unter Umgehung klassischer Medien zu kommunizieren. Auch ÖVP, SPÖ und Grüne forcieren eigene mediale Kanäle. Warum?
Pörksen
Tatsächlich, die längst totgesagte Parteipresse kehrt in digitalem Gewand zurück. Der zentrale Gedanke: Filtervermeidung, Direktkontakt zum Publikum, unmittelbare, gleichsam unverzerrte Polit-PR, vielleicht mit journalistisch-publizistischer Ummantelung, um die Glaubwürdigkeit noch zu steigern. Man umgeht so die unabhängige Einordung, die ja immer auch bedeuten könnte, dass man fundiert und gut begründet kritisiert wird.
Oft sagen parteiische Medien nicht, dass sie parteiisch sind, verschleiern ihre Geldgeber, nennen sich gar die wahren kritischen und unabhängigen Medien. Wie soll man sich da auskennen?
Pörksen
David Weinberger, ein Netzanalytiker der ersten Stunde, hat einmal eine hübsche Übertreibung formuliert, die da heißt: Transparenz ist die neue Objektivität. Und tatsächlich, wir müssen einordnungs-und einschätzungsfähig werden, nicht nur im Blick auf journalistische Angebote, sondern auch im Blick auf Plattformen und soziale Netzwerke. Auch die haben ein publizistisches Programm, eine redaktionelle Linie. Und ich würde als User gerne wissen: Wie viel Geld verdient man mit politischer Werbung? Warum lässt man Holocaust-Leugner gewähren? Und wie werden jene bezahlt und betreut, die als unsichtbare Müllsortierer in Indonesien viele Stunden am Tag Enthauptungsbilder aus dem Netz fischen? Hier Transparenzpflichten einzufordern, sie auch zu erzwingen -das wäre so etwas wie das Gebot der Stunde.
In Österreich floss sehr viel Steuergeld in gewinnorientierte Boulevardmedien, während Qualitätsmedien ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Wie kann staatliche Medienförderung Qualität stärken?
Pörksen
Indem sie die Qualitätsfrage, so heikel die auch ist, ins Zentrum stellt, sie jedoch nicht selbst beantwortet, sondern an politikferne Instanzen und tatsächlich unabhängige Expertinnen und Experten delegiert, denen man auch die Vergabe der Inseraten-und Fördergelder überträgt. Die einfache Lehre aus dem gegenwärtigen Fördersystem: Die Verbindung von Politik und Medien ist, erstens, viel zu eng, viel zu direkt. Das schafft ungute Abhängigkeiten. Und zweitens: Bloß formale Kriterien wie die Höhe der Druckauflage sind kein Förderkriterium. Denn bunt bedrucktes Papier ist nicht per se demokratierelevant.
Wie könnte es weitergehen?
Pörksen
Meine Hoffnung wäre, dass nach den Skandalen um Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz, die sich ja in ihrer Stoßrichtung -Angriff auf den unabhängigen Journalismus - gleichen, nun ein gesellschaftliches Momentum entsteht, eine partei-und medienübergreifende Allianz, die sagt: Die gegenwärtige Medienförderung setzt zu viele Fehlanreize. Und deshalb ändern wir sie jetzt fundamental.
Einst erklärte eine auserlesene Schar von soignierten, in der Regel männlichen Kommentatoren die Welt. Birgt die - auch dank sozialer Medien heute größere Vielfalt am Ende mehr Chancen oder mehr Gefahren?
Pörksen
Das ist noch offen. Denn an die Stelle des Kommentatoren-Patriarchats sind längst neue Mächtige getreten, oft vollkommen intransparent agierende Plattform-Betreiber, verborgene Gatekeeper. Das ist doch das merkwürdige Paradox der digitalen Zeit: einerseits die gigantische Öffnung des kommunikativen Raumes, die gerade noch Marginalisierten Sichtbarkeit und Stimme verleiht. Das scheint mir ganz wunderbar. Und es ist tief berührend, zu sehen, wie sich soziale Medien in Kriegszeiten einsetzen lassen, um Menschen beizustehen, Mut zu machen, Schutzsuchende zu verknüpfen. Andererseits lässt sich eine totale Vermachtung von Öffentlichkeit konstatieren - ganz viel Einfluss für ganz wenige, die nach Belieben ihre Spielregeln setzen. Man denke nur an Elon Musk, den neuen Twitter-Besitzer.
Musk rief eine "Generalamnestie" für alle bisher gesperrten Accounts aus. Hassredner, Leugner des Klimawandels, Anhänger von Verschwörungserzählungen, alle sollen alles sagen dürfen. Wohin führt diese uneingeschränkte Freiheit?
Pörksen
In ein Aggressions-und Desinformationsspektakel, das geeignet ist, die Diskurs-und Strategiefähigkeit ganzer Gesellschaften zu untergraben. Deshalb kommt es jetzt in offenen Gesellschaften darauf an, um eine Formulierung des Philosophen Carl Friedrich von Weizsäcker aufzugreifen, den Raum der Freiheit zu planen. Wie kann es gelingen, gegen Hass, Hetze und Desinformation zu kämpfen - und gleichzeitig die Ideale von Kommunikationsfreiheit und Mündigkeit zu erhalten, die einer Demokratie überhaupt erst ihre Würde geben? Das ist die Schlüsselfrage unserer Kommunikationszukunft.
Bernhard Pörksen
ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Kürzlich erhielt er gemeinsam mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun im Frankfurter Rathaus den Preis "Gegen Vergessen -für Demokratie" für ihr gemeinsames Buch: "Die Kunst des Miteinander-Redens"