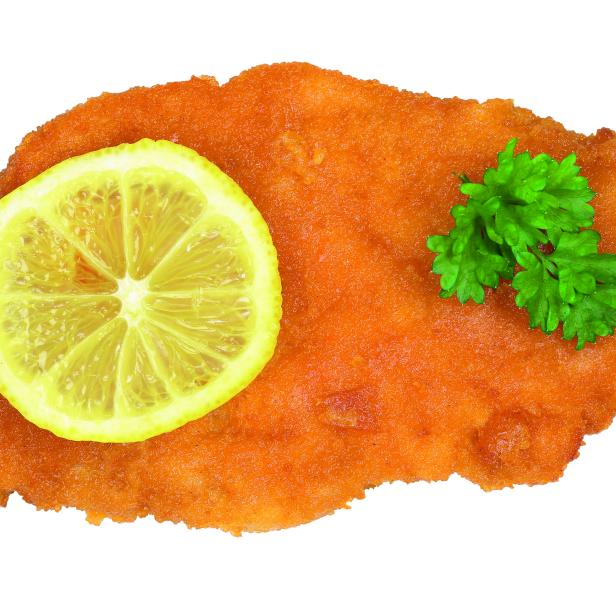Ein Arbeiter mit Gummistiefeln steht auf einem blutverschmierten Boden.
"Ich mache alles - außer Fleisch"
In den kalten Hallen sah er "Riesenkerle mit Muskeln aus Eisen" knöcheltief im Blut stehen, viele von ihnen Einwanderer, die arbeiteten, "als säße ihnen der Teufel im Nacken". Mit schnellen Schnitten schlitzten sie Schweinen die Kehle auf, zersägten Brustbeine, zogen Därme aus Rindern, kehrten mit Eisenbesen den Abfall in die Löcher am Boden. Monatelang hielt Upton Sinclair sich unter den Schlachtern, Spaltern, Köpfern und Anstechern auf. Am Abend ließ er sich in ihren engen Behausungen die Geschwüre zeigen, die sie sich in den Pökelkellern zugezogen hatten, die gebrochenen Daumen und zerschnittenen Gliedmaßen. Und er notierte, was die Regierungsinspekteure nicht sehen sollten oder wollten: Arbeiter, die in den Schmelzkessel fielen und zu "garantiert reinem Schweineschmalz" mitverarbeitet wurden. Unfassbare hygienische Zustände. Tausendschaften, die bis zum Umfallen schufteten, weil über ihnen "die Peitsche der Armut knallte".
Die Schilderungen erschienen 1906 unter dem Titel "The Jungle" als Roman und erschütterten die amerikanische Öffentlichkeit bis ins Mark. US-Präsident Theodore Roosevelt schickte zwei Abgesandte, die sich in den Union Stock Yards von Chicago umsahen. Es folgten Gesetzesänderungen. Sie beschränkten sich allerdings darauf, die Hygiene in den Betrieben und die Sicherheit der Nahrungsmittel zu verbessern. Um die Arbeiter ging es nicht. Er habe "auf die Herzen der Menschen gezielt, aber ihre Mägen getroffen", bemerkte Upton Sinclair später.
"Überall dort, wo die Arbeits- und Lebensverhältnisse nicht dem Standard entsprechen, gibt es in Krisenzeiten Probleme"
Die Verhältnisse sind nicht mehr so infernalisch wie im ausgehenden 19. Jahrhundert, weder in der Fleischindustrie noch in den Arbeitervierteln. Und doch erscheint manches erschreckend aktuell. Anfang Mai infizierten sich Arbeiter im deutschen Westfleisch-Werk in Coesfeld. Nun sorgt der Gütersloher Schlachtbetrieb Tönnies mit über 1500 Ansteckungen für einen neuen Corona-Hotspot. 7000 Menschen sind hier beschäftigt, viele von ihnen Werkvertragsarbeiter aus den europäischen Armenregionen Rumänien, Bulgarien und Moldawien, die jede Stelle annehmen müssen, sich oft ein Mehrbettzimmer teilen und sozial kaum abgesichert sind. Sie arbeiten schon lange in den wirtschaftlich starken Zonen Europas. Die Pandemie macht sie nur sichtbar, sagt Migrationsforscherin Gudrun Biffl: "Überall dort, wo die Arbeits-und Lebensverhältnisse nicht dem Standard entsprechen, gibt es in Krisenzeiten Probleme." In Portugal steckten sich im April 140 Flüchtlinge in einer Unterkunft an. In Österreich wurden im Mai die Postzentren Hagenbrunn und Inzersdorf zu Covid- 19-Clustern.
Fast alle Grenzen in Europa sind wieder offen. Die Mobilität kehrt zurück, der Tourismus erwacht aus der Corona-Starre. Auch die Asylanträge, die im April europaweit um 87 Prozent unter dem Vorjahr lagen, dürften bald steigen. Die Grenzschutzagentur Frontex meldet verstärkte irreguläre Migration über die Mittelmeerroute. Ob die Pandemie vorbei ist, entscheidet sich nicht zuletzt in den versteckten Ecken der wohlhabenden Staaten. Anfangs erwischte die Pandemie die gut situierte, mobile Mittelschicht, Geschäftsreisende, Tagungsteilnehmer, Touristen. Nun holt sie sich ihre Opfer zunehmend unter den Ärmeren, die in beengten Verhältnissen leben und unter schlechten Bedingungen arbeiten. In der Corona-Krise gehörten viele von ihnen zu den "Systemerhaltern", die selbst in der Hamsterphase zu Beginn des Lockdowns für einen nicht versiegenden Nachschub sorgten. "Service Class" nennt sie der deutsche Soziologe Andreas Reckwitz.
Politik und Öffentlichkeit sind aufgerüttelt. EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit warnte angesichts des Corona-Ausbruchs in der deutschen Fleischindustrie, Saisonarbeiter und Grenzgänger auszubeuten und den Zugang zu öffentlichen Leistungen zu verwehren, räche sich in der Pandemie. Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die umstrittenen Werkverträge verbieten. Vor Kurzem hieß es noch, ohne sie würde die Fleischindustrie implodieren. Hierzulande sind die Dimensionen deutlich kleiner: Der steirische Schlacht-und Zerlegebetrieb Marcher ist mit neun Standorten und 1800 Mitarbeitern bereits der Größte seiner Zunft. Außerdem zählt Österreich zu den Ländern mit den schärfsten Anti-Lohn-und Sozialdumping-Bestimmungen in Europa. Trotzdem ist die Fleisch-und Wursterzeugung eine Problemzone, sagt Erwin Kinslechner, Branchensekretär Nahrung in der Pro-Ge (Produktionsgewerkschaft). In den Betrieben seien fast nur angelernte Hilfskräfte am Werk, viele von ihnen Leiharbeiter, Wochenpendler und Grenzgänger. Teile der Produktion werden an Trupps sogenannter Fremdarbeiter ausgelagert, die etwa in der Kutterei das Brät für die Würste mischen.
"Die Fluktuation ist hoch. Manchmal bekommen wir zu hören: ,Ich mache alles - außer Fleisch'"
Ab und zu bekommt Kinslechner einen Zettel in die Finger, auf dem ein Monatslohn von 1400 Euro netto ausgewiesen ist - keine Prämien, keine Zulagen, aber 300 Euro werden für das Quartier abgezogen. Der Gewerkschafter würde damit gerne vor Gericht gehen. Doch kaum ein Betroffener zieht mit. Zu groß ist die Angst, die Stelle zu verlieren und keine neue zu finden. "Die Firmenchefs sind gut vernetzt", sagt Kinslechner. Einmal habe er sich mit ungarischen Arbeitern auf einem Parkplatz getroffen. Im Unternehmen habe man davon Wind bekommen. Bald darauf seien zwei seiner Gesprächspartner gekündigt und die anderen nicht mehr erreichbar gewesen. Viele sprechen kaum Deutsch, unterschreiben Zettel, die sie nicht verstehen, bleiben unter sich. Bevor sie durchschauen, was im Betrieb läuft, sind sie meist wieder weg. "Die Fluktuation ist hoch. Manchmal bekommen wir zu hören: ,Ich mache alles - außer Fleisch'", bestätigt ein AMS-Mitarbeiter aus Niederösterreich. Auch die Arbeitskräftevermittler sitzen oft nicht in Österreich. Als Gewerkschafter Kinslechner in Ungarn einmal einen Firmenstandort inspizierte, fand er nichts als "ein kleines Briefkasterl, bei dem ab und zu jemand die Post abholt".
Dass die Corona-Pandemie eine Vorbotin künftiger Krisen sein könnte, bezweifelt kaum jemand. Werden daraus Lehren gezogen? "Der Befund, dass eine gute Integration eine Gesellschaft widerstandsfähiger macht, ist nicht neu", sagt Politikwissenschafter Bernhard Perchinig. Sprich: Nur wenn alle eingebunden sind, werden Krisen steuerbar. Pandemien (wie auch Blackouts oder Überschwemmungen) betreffen Bürger und Migranten gleichermaßen. Im Krisenmanagement wird auf die zweite Gruppe oft vergessen. Perchinig konzediert Österreich einen gut organisierten Katastrophenschutz. Bei Vorsorgekampagnen aber bleiben 1,9 Millionen Menschen ausgeblendet. So viele Migranten sowie Kinder aus Migrantenfamilien leben laut Statistik Austria im Land. Viele davon sprechen Deutsch, aber längst nicht alle. Einschlägige Broschüren und Websites sind zwar meist auch in Englisch verfügbar, aber in keiner der Muttersprachen der Einwanderer . Die Handy-App "Katwarn" des Innenministeriums existiert überhaupt nur auf Deutsch.
Was passiert, wenn Menschen für die Behörden nicht erreichbar sind, zeigt sich derzeit in Deutschland. Als der Lockdown drohte, setzten sich Tönnies-Werkvertragsnehmer Richtung Bulgarien oder Rumänien ab. Dass ein Teil das Virus mit sich nahm, ist zu vermuten. Auch nach Ungarn kam Covid-19 vor Monaten durch Landsleute, die in Italien, Österreich und Deutschland als Saisonniers, auf dem Bau und im Tourismus gearbeitet hatten und nach Hause wollten (oder kurzerhand hinausgeworfen wurden), bevor die Grenzbalken überall hinuntergingen. Menschen, die gravierende Nachteile fürchten und Institutionen misstrauen, handeln nicht immer im Sinne des Großen und Ganzen. In einer Pandemie wird das schnell zu einer Bedrohung für alle.
Prekäre Strukturen gibt es überall dort, wo niedrige Löhne und unsichere Beschäftigung zusammenfallen, in der 24-Stunden-Pflege, bei der Feldarbeit, im Gastgewerbe, aber auch auf dem Bau, wo Kontrollore regelmäßig auf Scheinselbstständige treffen. Thomas Grammelhofer kümmert sich in der Pro-Ge um die über alle Branchen verstreuten Leiharbeiter; 90.000 zählt die Statistik (Stand 2018). Seine Beobachtung: Klassische Industrien wie die Motorenfertigung drosselten die Produktion und fuhren sie erst hoch, als die Abstände neu vermessen, technische Schutzeinrichtungen montiert und Trennwände aufgestellt waren. In Logistikzentren, wo der Betrieb ohne Pause weiterging, ist Social Distancing schwieriger. Vor wenigen Wochen sprach profil mit einem somalischen Leiharbeiter in einem Postzentrum. Seine Angst vor dem Virus war deutlich geringer als die Angst, den Job zu verlieren. Der Druck, fiebrig, verschnupft, medikamentös schmerzfrei zum Dienst zu erscheinen, wird umso höher, je knapper das Personal ist, sagt Arbeitssoziologe Jörg Flecker: "Selbst im Gesundheitswesen ist es schwer, zu Hause zu bleiben, weil oft niemand einspringen kann. Dann werden Leute an freien Tagen hereingerufen, haben weniger Erholung, werden anfälliger für Erkrankungen, und das in einem Bereich, wo ohnedies viele Viren und Keime sind."
Arbeitskräfte, die keine Staatsbürger und nur kurz im Land sind, gelten als besonders gefährdet. Sie sind politisch nicht vertreten und können sich schwer gegen Ausbeutung wehren. Bei AmberMed in Wien, einer Einrichtung der Diakonie, behandeln Ärztinnen und Ärzte ehrenamtlich jene Unversicherten, die es im Sozialstaat Österreich offiziell gar nicht gibt: Tagelöhner, die auf Märkten Kisten auf-und abladen, Ukrainerinnen, die schwarz in Haushalten putzen, immer öfter auch Paketzusteller, denen nicht genug bleibt, um sich selbst zu versichern; Bauarbeiter, die ohne ihr Wissen abgemeldet wurden und illegale Pflegerinnen, die innerhalb von Migranten-Communities unter der Hand vermittelt werden.
Bis Mitte des Jahrhunderts wird sich der Anteil der über 80-Jährigen in allen OECD-Ländern von fünf auf zehn Prozent der Bevölkerung verdoppeln. Laut einer aktuellen Studie werden bis 2040 zusätzlich 13,5 Millionen Pflegekräfte gebraucht. Flavia Matei setzt sich für Rumänen und Rumäninnen ein, die in Österreich Menschen in ihren eigenen vier Wänden betreuen. Obwohl viele 24-Stunden-Betreuer, das Gros davon Frauen, im Lockdown festsaßen, bekommen sie aus dem Härtefallfonds keinen Euro - die Hürden sind zu hoch. Auch die angekündigten "Bleib da"-Boni wurden noch nicht ausbezahlt, erzählt Matei: "Seit Mitte Juni sind die Grenzen offen. Jetzt passieren gerade viele Turnuswechsel. Die Betreuerinnen und Betreuer, die jetzt nach Hause fahren, wissen nicht, ob sie zur selben Familie zurückkehren und wie sie an ihr Geld kommen."
"Viele waren körperlich und psychisch am Ende und mussten auch noch Masken, Desinfektionsmittel und Handschuhe selbst kaufen"
Wie vor Corona reisen sie mit Kleinbussen hin und her. Verpflichtende Schutzmaßnahmen für die Transportunternehmen, deren Interesse es ist, möglichst viele Passagiere in ein Auto zu stopfen, gibt es nicht. Die 24-Stunden-Betreuerinnen und -Betreuer seien als Helden gefeiert worden, um ihren Schutz aber habe sich niemand gesorgt, sagt Matei: "Viele waren körperlich und psychisch am Ende und mussten auch noch Masken, Desinfektionsmittel und Handschuhe selbst kaufen." Ähnliche Zustände herrschten in der Fleischbranche. Als die Mitarbeiter in den Supermärkten die Waren nicht so schnell nachschlichten konnten, wie Kunden sie aus den Regalen rissen, arbeiteten in den Fleischbetrieben serbische, ungarische und rumänische Leiharbeiter ebenfalls bis zur Erschöpfung. Die Handelsangestellten bekamen ein wenig Applaus, am Ende sogar eine Prämie. Die Systemerhalter dahinter blieben unsichtbar. "Das hat viele zornig gemacht", sagt Gewerkschafter Kinslechner. Nun macht die Pandemie auch sie sichtbar.