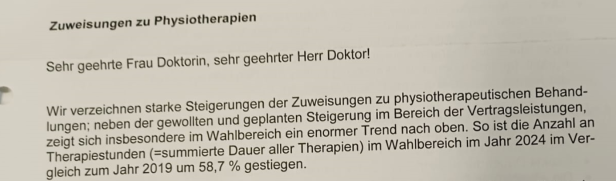Enorm hohe Verwaltungskosten
Die ÖGK nimmt heuer 21 Milliarden Euro ein – für die Versorgung von 7,6 Millionen Versicherten. Der größte Ausgabenposten sind Ärztehonorare mit 5,5 Milliarden Euro. Weitere 5,3 Milliarden muss die ÖGK zur Finanzierung der Spitäler beisteuern, bei denen sie aber nicht mitreden darf. Medikamente verschlingen vier Milliarden Euro, über eine Milliarde kostet das Krankengeld. Aber auch der Verwaltungsaufwand der Kasse ist enorm, sie beschäftigt knapp 11.000 Vollzeitkräfte – 4000 davon arbeiten in den ÖGK-eigenen Gesundheitszentren. Der Rest verwaltet.
Ein Hauptargument für die Kassenfusion vor fünf Jahren war: Wenn neun Gebietskrankenkassen zu einer Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) verschmelzen, dann wird die Verwaltung in Summe billiger – zum Beispiel durch eine zentrale IT. Doch die versprochene Patientenmilliarde hat sich als Luftschloss entpuppt, schlimmer noch: Statt Einsparungen brachte die Fusion bisher saftige Mehrkosten in der Verwaltung.
Das zeigt die ÖGK-Budgetprognose für das Jahr 2025, die profil vorliegt. Laut dem vertraulichen Excel-File werden die Verwaltungskosten der Kasse heuer auf 453 Millionen Euro anschwellen. 2020, im ersten Geschäftsjahr nach der Fusion, waren sie noch bei 326 Millionen Euro gelegen. Das entspricht einer Explosion von 38 Prozent in nur fünf Jahren – und liegt deutlich über der Inflation im Vergleichszeitraum. Geld, das für Ärztehonorare, Medikamente und Rehas fehlt. Als die ÖGK vor drei Wochen ihre Budgetmisere öffentlich machte, fanden die Verwaltungskosten in der Presseaussendung allerdings keine Erwähnung.
Die Wiener Ökonomin Maria M. Hofmarcher hat die besagte Pressemeldung „ziemlich irritiert“: „Die Beiträge zur ÖGK sind gesprudelt, angetrieben durch die Inflation. Über den Finanzausgleich bekommt die Sozialversicherung jetzt noch einmal 300 Millionen Euro mehr, und in den nächsten Jahren erhöhen sich die Einnahmen noch einmal um etwa 600 Millionen Euro pro Jahr deutlich, vor allem bedingt durch die gestiegenen Beiträge der Pensionistinnen und Pensionisten. Für mich ist dieses Defizit nicht erklärbar, die Beteuerungen der Kasse sind intellektuell eine Zumutung.“ Die Kostensteigerungen in der Verwaltung bezeichnet sie als „bedauerlich und bedenklich“. Die ÖGK hält fest, dass nur zwei Prozent ihres Budgets in die Verwaltung fließen. Das stimmt. Doch sind zwei Prozent von 21 Milliarden Euro eben knapp eine halbe Milliarde Euro.
Wie ist es zu erklären, dass sich die oft versprochenen Einsparungen in den Zahlen nicht widerspiegeln?
Ein Grund ist die komplexe Finanzstruktur, etwa bei der Patientensteuerung. Die Ärztekammer forderte am Montag eine Reform der ÖGK und eine effektivere Lenkung der Patientenströme – etwa durch den Ausbau der Gesundheitshotline 1450 und ein bundesweites Tele-Arzt-Service, um Kosten zu sparen. In Wien sollen schon ab Herbst Ambulanztermine über die Hotline vergeben werden. Die Idee: Wer krank ist, soll zuerst zum Telefon greifen – und Fachärztinnen und Fachärzte oder Spitalsambulanzen nur dann aufsuchen, wenn es medizinisch wirklich notwendig ist. Doch ein Blick zurück zeigt, wie träge sich diese Steuerung in der Realität auswirkt. Mit der großen Reform von 2018 wurden zwar die stationären Aufenthalte um ein Viertel reduziert – die Kosten jedoch kaum.
Bis 2018 wurden Spitalsstationen nach Aktivitätsauslastung bezahlt – mehr Patienten bedeuteten mehr Bezahlung. Ambulanzen erhielten eine Globalbudgetierung. Seither gilt auch dort das Prinzip der Leistungsvergütung – mit unerwünschten und teuren Nebenwirkungen. Auch an der zentralen Geldverteilung hat sich bis heute nichts geändert: Die ÖGK zahlt nach wie vor rund 43 Prozent der Spitalskosten – pauschal an die Landesgesundheitsfonds. Für alles, was außerhalb der Spitäler passiert, etwa in Arztpraxen, muss sie zusätzlich aufkommen. Der Gesundheitsökonom Thomas Czypionka nennt das die „Tragödie des österreichischen Gesundheitssystems“. Denn die grundlegende Fehlkonstruktion bleibt: Fixkosten in den Spitälern – etwa für Personal und Infrastruktur – bleiben bestehen, auch wenn weniger Patienten kommen. Eine Ambulanz zu entlasten, heißt noch lange nicht, dass eine Station geschlossen oder Personal abgebaut werden kann. Die Kosten laufen weiter.
Kostensteigerung durch Kassenfusion
Ein Insider berichtet profil außerdem davon, dass die Kostensteigerungen ausgerechnet auf die Kassenfusion zurückzuführen sind. Denn der Personalstand in der Verwaltung habe sich in den vergangenen fünf Jahren nicht erhöht. Wohl aber überweise die Kasse immer noch viel Geld an Berater, die beim Fusionsprozess helfen sollen. Dazu sagte die ÖGK nichts. Die erhöhten Verwaltungskosten führt die Kasse auf profil-Anfrage auf die Energiepreise und „strategisch essenzielle Weiterentwicklungen“ im Bereich IT und Digitalisierung zurück. Das werde, so die ÖGK, „zu mehr Effizienz und Einsparungen in den kommenden Jahren führen“.
„Ich glaube immer noch, dass die Fusion grundsätzlich eine gute Idee war, man hat sie nur faktisch nicht durchgeführt“, sagt der Gesundheitsökonom Martin Halla von der Wirtschaftsuniversität Wien: „Das Schild wurde ausgetauscht, aber vieles wurde in Landeskompetenz belassen.“ Was er meint: Über die neun Gebietskrankenkassen wurde eine Dachorganisation gestülpt, ohne an den Strukturen darunter viel zu ändern.
Weiterhin gibt es neun unterschiedliche Leistungsverträge mit den Landesärztekammern. Darin ist festgehalten, welchen Betrag die Kasse ihren Vertragsärzten für Leistungen wie Blutabnahmen und EKGs erstattet. Es sind für jede Leistung neun unterschiedliche Beträge. Vereinheitlichungsversuche sind bisher gescheitert. Ärztekammer und ÖGK geben sich dafür wechselseitig die Schuld. Ergebnis: Die Kasse muss neun verschiedene Abrechnungssysteme stemmen. Dazu kommen noch die Rückerstattungen für Wahlarztbesuche, die teils noch händisch gemacht werden.
Kommt jetzt der Gesamtvertrag?
Der stellvertretende ÖGK-Obmann Andreas Huss, ein Arbeitnehmervertreter, erklärt den fehlenden Gesamtvertrag so: „In den westlichen Bundesländern gibt es höhere Honorare. Keine Landesärztekammer will Honorarkürzungen, alle wollen den Höchstsatz. Das würde eine Milliarde mehr kosten. Ich kann niemanden zum Vertrag zwingen. Zwingen könnte uns nur die Bundesregierung, indem sie per Verordnung verlangt, dass der Gesamtvertrag bis zum Tag X fertig ist, sonst gilt ein Vertrag aus einem Bundesland.“ Ob Gesundheitsministerin Korinna Schumann die Rufe ihres ÖGB-Kompagnons erhört?