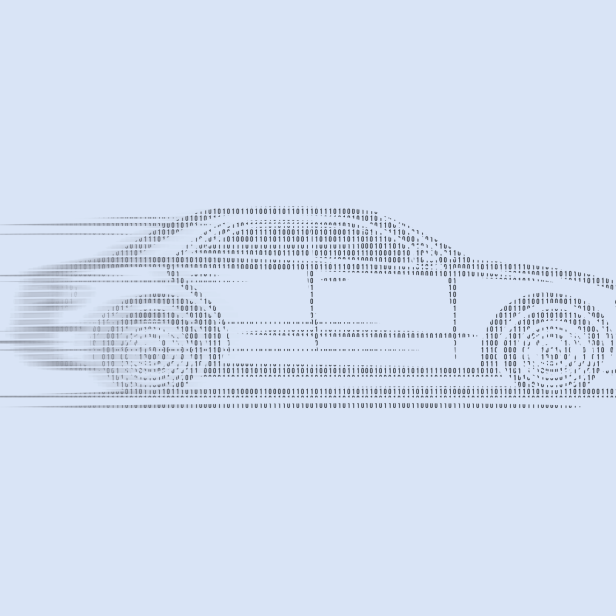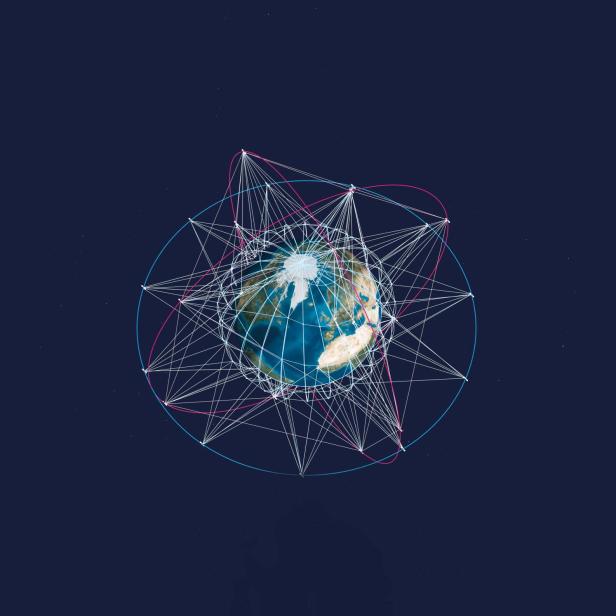IT is a problem
Der Kaffee ist längst kalt. Der Kuchen wird langsam trocken. Kurz überlegt Christiane M., ob sie zum Handy greifen soll. Doch sie spart sich den Anruf. Er wird sowieso nicht rangehen. Dabei hatte sie diesmal ein gutes Gefühl gehabt. „Es hätte etwas werden können mit uns ...“
Es ist nicht das erste Mal, dass die 46-Jährige versetzt und geghostet wurde. Ginge es ums Dating, sie hätte schon das Handtuch geworfen. Doch hier steht nicht ihr privates Glück auf dem Spiel, sondern die Zukunft ihrer Software-Firma.
Ihren vollen Namen oder jenen ihres Unternehmens möchte sie nicht veröffentlicht wissen. Dabei sollte sie eigentlich selbstbewusst trommeln können. Ihr Betrieb wuchs ähnlich rasant wie die gesamte IKT-Branche, deren Umsatz und Unternehmensanzahl sich seit 2010 nahezu verdoppelte und die 60.000 neue Jobs schuf. Doch die Tatsache, dass sie Stellenzeigen auch nach einer erfolgreichen Neueinstellung nicht deaktiviert, um ihren steigenden Personalbedarf zumindest halbwegs zu decken, erfüllt Christiane M. längst nicht mehr mit Stolz, sondern mit Scham und Sorge. „Aufgrund fehlender Mitarbeiter:innen muss ich Kunden ständig vertrösten, neue Anfragen ablehnen. Das beschädigt Ruf, Umsatz und Ego.“
Die Scham mag nicht berechtigt sein. Die Sorge schon. Christiane M. teilt sie mit vielen Unternehmer:innen. Für den Österreichischen Infrastrukturreport 2025
um ihre Einschätzung gebeten, antworteten 62 Prozent der heimischen Manager:innen auf die Frage, ob der Fachkräftebedarf im IT-Bereich hierzulande ausreichend gedeckt sei, klar mit Nein. 51 Prozent fehlt bereits Personal, insbesondere in den Bereichen Cybersecurity, Programmierung, Systemadministration und Netzwerktechnik. Dabei geht es nicht um einzelne Schlüsselpositionen. Alleine in der IT-Branche können laut einer Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts derzeit 12.000 Arbeitsplätze nicht besetzt werden. Österreichweit fehlen insgesamt sogar mehr als 28.000 IT-
Fachkräfte, quer durch alle Bereiche der Wirtschaft. „Bis 2030 könnte sich die Zahl auf fast 39.000 erhöhen“, sagt Alfred Harl, Obmann des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) der WKO und Präsident des europäischen Beratungsverband FEACO.
Der Konjunkturmotor stottert
Der Mangel bedroht längst nicht mehr nur die Branche selbst, sondern den gesamten Wirtschaftsstandort. Der Umsatz der inzwischen knapp 24.000 IKT-Unternehmen in Österreich beträgt heute 47,6 Milliarden Euro. Das sind fast zehn Prozent vom heimischen BIP. „Wenn also diese Branche stockt, stockt letztlich Österreich“, so Harl. Schon jetzt entgehen der heimischen Wirtschaft durch den IT-Fachkräftemangel jährlich 4,9 Milliarden Euro an Wertschöpfung, bald werden es 6,8 Milliarden sein. Jede fehlende IT-Fachkraft schlägt durchschnittlich mit 175.000 Euro Verlust zu Buche.
4,9 Milliarden Euro an Wertschöpfung entgehen Österreichs Wirtschaft jährlich durch den IT-Fachkräftemangel. Bald werden es 6,8 Milliarden sein.
Zudem ist die Branche weit mehr als nur ein wichtiger Konjunkturmotor und Garant für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Wohlstand. Sie ist das Fundament für alle strategisch wichtigen Digitalisierungsprojekte der Zukunft – vom Klimaschutz über die Verkehrswende und das Gesundheitswesen bis hin zur Verwaltung. „Der IT-Fachkräftemangel verlangsamt die Transformation“, mahnt Harl. „Wir verspielen unsere digitale Zukunft.“
Der Elefant steht nicht erst seit gestern im Raum. Demograf:innen warnen mit Blick auf die Pensionierungswelle der Babyboomer bereits seit Jahrzehnten vor ihm. Doch getan hat sich seitdem (zu) wenig. Nicht nur in Österreich, in der gesamten EU. Denn auch auf europäischer Ebene fehlen eine Million IT-Fachkräfte, in fünf Jahren werden es acht Mal so viele sein. Christiane M. spürt das bereits. Früher hatte sie Jobannouncen auch in anderen EU-Ländern geschaltet. Das spart sie sich mittlerweile. „Der Markt ist leer.“
Bei der Suche nach IT-Leuten blickte die Unternehmerin nach der Pandemie daher weiter, viel weiter. Heute arbeiten zwei Inder, ein Nigerianer und eine Brasilianerin für sie. Allerdings remote. Denn auch die wenigen, die zuvor überhaupt bereit gewesen waren, ihre Familien zu verlassen, kehrten schnell in ihre Heimat zurück. „Sie waren hier einfach nicht glücklich. Die Willkommenskultur in Österreich hat noch viel Luft nach oben“, sagt sie. „In ihren Herkunftsländern können meine Mitarbeiter:innen mit ihrem Gehalt hingegen fürstlich leben und haben weniger Scherereien – angefangen bei der Wohnungssuche bis hin zum Kindergartenplatz.“ Mit dem Remote-Modell einhergehende Probleme wie die Zeitverschiebung, komplexe Verträge oder Englisch als Arbeitssprache nimmt sie in Kauf. „Diese Hürden sind fast ein Klacks im Vergleich zum bürokratischen Kampf um die Arbeitsgenehmigungen.“
„Es gilt, Anreize für pensionsberechtigte ITler zu schaffen, damit sie weiterarbeiten, und parallel die Fachkräfte von morgen auszubilden.“
Alfred Harl, Obmann des Fachverbands UBIT der WKO
Alfred Harl teilt die Kritik der Unternehmerin. Zwar habe man die Rot-Weiß-Rot-Karte für qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten im Oktober 2022 reformiert und die Kriterien erleichtert. Seither wurden auch 53 Prozent mehr Anträge bewilligt. Dennoch befand selbst der Rechnungshof, dass das System mit seinen schwer voneinander abgrenzbaren Kartenvarianten (fünf bei der RWR-Karte plus die Blaue Karte EU) noch immer „komplex und für Antragstellende schwer verständlich ist“. Und für die Lösung privater Themen, die mit der Relocation verbunden sind, fehle es sowieso an klaren Wegweisern, so Harl.
Deshalb hätte Österreich auch die Chance nicht nutzen können, die sich mit den aus der Ukraine geflohenen IT-Spezialist:innen bot, sagt der UBIT-Obmann. Und darum drohen selbst innovative Ansätze für die Anwerbung aus Staaten, die aufgrund ihrer jungen, mobilen und gut ausgebildeten Bevölkerung das Potenzial hätten, die heimischen Personallücken zu schließen, letztlich zu verpuffen. Etwa der virtuelle Hackathon, den die WKO gemeinsam mit dem Arbeitsministerium und der Austrian Business Agency (ABA) im Herbst 2023 in Brasilien veranstaltet hatte, um Fachkräfte auf Jobmöglichkeiten in Österreich aufmerksam zu machen. Oder die Projekte am Balkan. In Albanien werden etwa an der HTL Peter Mahringer IT-Studierende nach österreichischem Lehrplan ausgebildet. Und im Kosovo hat man in Kooperation mit einem IT-Ausbildungszentrum das Zertifizierungssystem angepasst, um den Absolvent:innen einen leichteren Zugang zu Österreichs Arbeitsmarkt zu ermöglichen. „Doch erst wenn wir geeigneten Kandidat:innen auch einen niederschwelligen Implementierungspfad zeichnen können, den jede:r kennt und gehen kann, um bei uns zu arbeiten und zu leben, werden Bemühungen, ausländische Fachkräfte zu gewinnen, auch fruchten“, so Harl.
Ein schwieriges Thema
Auf dieses Fruchten kann und will Christiane M. nicht setzen, auch wenn sie „Blütenansätze“ erkennt. So begrüßt sie etwa, dass 2019 mit der Abteilung „Work in Austria“ der ABA eine zentrale Anlaufstelle für Fachkräfte geschaffen wurde, die den Außenauftritt der Republik koordiniert. Doch sie glaubt nicht, „dass es gelingt, den Standort Österreich in der wachsenden internationalen Konkurrenz derart zu stärken, dass wir durch den Fachkraft-Import die durch den demografischen Wandel klaffende und durch die fortschreitende Digitalisierung weiter wachsende Personallücke schließen können. Auch und vor allem, weil qualifizierte Zuwanderung ein schwieriges Thema ist und bleibt in der österreichischen Politik und eine einheitliche Kommunikationsstrategie kaum möglich ist.“
Ihre Hoffnungen liegen daher mehr und mehr auf der Künstlichen Intelligenz. Und sie ist damit nicht allein. So ging zum Beispiel jedes dritte deutsche IT-Unternehmen in einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom davon aus, mit Hilfe der KI Mitarbeiter:innen entlasten und Personalengpässe ausgleichen zu können. 20 Prozent wollen durch sie sogar Stellen ersetzen. Der Pferdefuß: Noch steckt die Technologie in den Kinderschuhen. Weshalb 38 Prozent der Befragten auch sagten, dass der KI-Einsatz kurz- bis mittelfristig keine Lösung sei, sondern Teil des Problems – weil er für einen zusätzlichen Bedarf an IT-Fachkräften im Unternehmen sorge. Irgendwer muss die Technik schließlich auch programmieren und überwachen. Hier beißt sich der Problem-Elefant in den Schwanz.
Klar ist: Im Kampf gegen den Fachkräftemangel braucht es auch andere Maßnahmen. Solche, die geeignet sind, das Potenzial im eigenen Land auszuschöpfen. Der Fachverband UBIT liefert sie den Entscheidungsträger:innen als Fünf-Punkte-Plan. Ein großer Hebel: die Babyboomer im Job zu halten. Denn die 10.000 ITler, die in den nächsten Jahren in Pension gehen, nachzubesetzen, wäre enorm schwierig – „zumal es sich bei ihnen großteils um EPUs handelt“, so Harl. Für sie gilt es, finanzielle Anreize schaffen, damit sie weiterarbeiten. „Die pauschalierte Besteuerung von 25 Prozent des Zuverdienstes ist ein erster Schritt. Auch die Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen für Zuverdienst beim ‚Arbeiten im Alter‘-Modell ab 2026 ist positiv. Doch wünschenswert wäre eine absolute Abgaben- und Steuerfreiheit.“
„Langfristig müssen wir schon jetzt aber auch an die IT-Fachkräfte von morgen denken und hier auf breiter Basis ansetzen“, sagt Harl. Zwar wurde die ,Digitale Grundbildung‘ an Mittelschulen und AHS-Unterstufen eingeführt. „Wir brauchen aber verpflichtenden Informatikunterricht ab der AHS-Oberstufe – zwei Stunden pro Woche mindestens – und einen Ausbau der IT-Lehre.“ Auch an den Hochschulen gibt es großen Aufholbedarf: Die Zahl der IKT-Studierenden ist zwar auf etwa 27.000 gestiegen, doch die Dropout-Quoten sind mit mehr als 40 Prozent weiterhin viel zu hoch. „In einem Betrieb würde niemand 40 Prozent der Mitarbeitenden einfach verlieren, ohne etwas zu ändern“, kritisiert der UBIT-Obmann. Er fordert bessere Studienberatung, eine gezieltere Ansprache potenzieller Studierender und ein Monitoring. Es müsse zudem gelingen, mehr Frauen für die IT zu gewinnen. „Könnten wir den Frauenanteil in den IKT-Studiengängen verdoppeln – derzeit bleiben wir mit 19,7 Prozent weit unter dem OECD-Schnitt –, würde Österreich jährlich 10.000 zusätzliche Abschlüsse erzielen.“
Weiteres Potenzial ortet er bei bereits im Berufsleben Stehenden. Unternehmen müssten neben den Fachkräften auch andere Mitarbeiter:innen in Sachen IT-Know-how fort- und weiterbilden. „Mit der E-Learning-Plattform wîse up der WKO, die inzwischen rund 20.000 Online-Kurse namhafter Anbieter im DACH-Raum bündelt, sind individuelle Lernpfade zu wichtigen Themen wie Technik und Digitalisierung möglich.“
> 40 % der IKT-Studierenden brechen ihr Studium ab. Gelänge es, die Dropout-Rate um zehn Prozent zu senken, stünden jährlich rund 2.000 neue Fachkräfte bereit.
Probiert's mal mit Begeisterung
Ob der Elefant „Fachkräftemangel“ auf diesem Wege Stück für Stück, wie sich das für Dickhäuter so empfiehlt, gegessen werden kann? Wird die Zeit zeigen. Doch Österreichs digitale Zukunft entscheidet sich leider nicht erst (über)morgen. Sondern jetzt. Und zwar auch daran, ob es gelingt, im Land das zu entfachen, was Alfred Harl – neben dem 5-Punkte-Plan, Investitionen und einer klaren digitalen Polit-Strategie – für die Conditio sine qua non hält: Aufbruchsstimmung im Land und Lust auf die Teilnahme an der Transformation, in allen Altersklassen. Was für den Silicon-Valley-Vibe sorgen soll? „Inspiration“, sagt der Experte. „Etwa großformatige Displays auf Bahnhöfen, die die über 80 IT-Berufsbilder sichtbar machen und zeigen, dass IT Kreativität bedeutet. Und wir brauchen Leuchtturmmenschen, die das Thema Digitalisierung nicht als Verwalter angehen, sondern mit Begeisterung Begeisterung schaffen.“
Zumindest bei Christiane M. ist die Message angekommen: Die Zukunft wartet nicht auf Zögerer, schon gar nicht mit kaltem Kaffee. Sie greift zum Handy. Mal sehen, wie viel Begeisterung sich via Mailbox entfachen lässt …
Text: Daniela Schuster