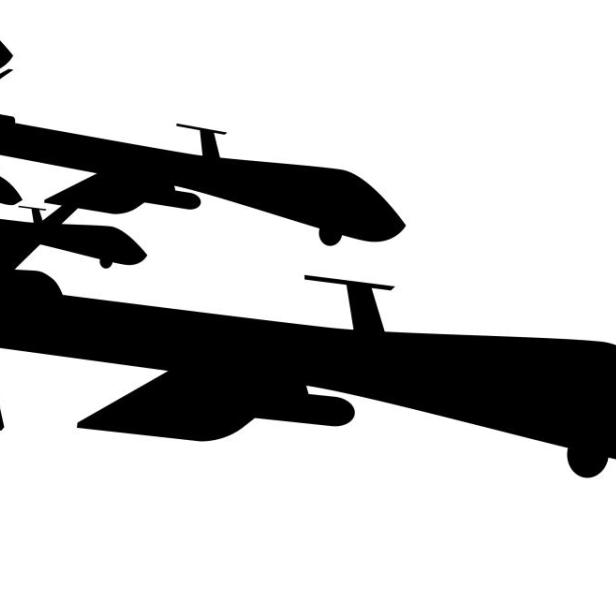Kann Europa es sich leisten, nicht zu reagieren?
Krastev
Europa kann nicht nicht reagieren – erst recht nicht, wenn die Länder an der Frontlinie am stärksten betroffen und provoziert werden. Aber: Nichts demonstriert eindringlicher die eigenen Schwächen, als wenn man reagieren will, und die Reaktion misslingt. Europa sähe schwach aus, wenn Flugzeuge, die kurz den Luftraum verletzen, unbehelligt zurückkehren. Europa sähe aber noch schwächer aus, wenn wir behaupten, so etwas nicht zuzulassen – und es dann doch tun.
Was raten Sie europäischen Staats- und Regierungschefs? Sie müssen jetzt entscheiden, was sie mit dem eingefrorenen russischen Vermögen tun werden.
Krastev
Sie sollten es der Ukraine zur Verfügung stellen, aus dem einfachen Grund, weil Europa kein anderes Geld mehr zur Verfügung hat. Und ein Kollaps der Ukraine würde eine Kaskade an Problemen für Europa erzeugen. Ein Durchbruch an der Frontlinie hieße eine neue Welle von Millionen Menschen an den EU-Grenzen – ein gewaltiger Migrationsschock. In den Grenzstaaten käme es zu Panik, was NATO und EU zusätzlich lähmen würde. Es entstünde eine Vertrauenskrise gegenüber allen Regierungen. Natürlich sehe ich aber die Risiken einer solchen Entscheidung: Die Maßnahme könnte den Status des Euro als Reservewährung beeinträchtigen. Rein rechtlich handelt es sich um eine Konfiskation fremden Eigentums. Russland wird reagieren – etwa durch Beschlagnahmung westlicher Aktiva auf seinem Territorium. Allein Österreich hat noch über fünf Milliarden Euro in Russland. Andererseits sehen wir ja jetzt schon am Beispiel von Raiffeisen, dass westliches Vermögen in Russland nicht mehr frei nutzbar ist.
Sie schrieben kürzlich in einem Essay in der „Financial Times“: „Die Europäischen Demokratien sind am Rande eines Nervenzusammenbruchs.“ Was meinen Sie damit?
Krastev
Schauen Sie nach Frankreich: Seit fast einem Jahr folgt dort eine Regierung auf die nächste. In allen Ländern gibt es starke antisystemische Parteien, man hat das Gefühl, die Demokratien sind nicht überzeugt, dass sie die aktuelle Krise aus eigener Kraft bewältigen können. Gleichzeitig sind Demokratien langsame Tiere. Das alles geschieht in einem Moment, in dem sich die Geschwindigkeit politischer Entscheidungen schlagartig verändert. Ein weiterer Grund für die Nervosität: Am schwersten passen sich jene an neue Situationen an, die am meisten von der vorherigen Weltordnung profitiert haben. Die europäischen Demokratien waren die großen Gewinner des Endes des Kalten Krieges. Das ermöglichte eine lange Phase des Friedens, der Integration der Wirtschaft und der Märkte, es entstand das Gefühl, ein Labor der Zukunft zu sein – andere wollten „wie wir“ werden. Aber plötzlich will keiner mehr sein wie wir. Ein deutscher Politiker hat mir einmal gesagt: „Wir Europäer sind Vegetarier, die zum Abendessen bei Kannibalen eingeladen sind.“ Wir wollen einen Status quo verteidigen, den es nicht mehr gibt.
Wie kommt man aus dieser Situation heraus?
Krastev
Der verstorbene russische Dichter und Sänger Wladimir Wyssozki hat ein Lied mit der Zeile komponiert: „Es gibt keinen Ausgang, nur einen Eingang – und es ist nicht dieser hier.“
Sie gehören zu den wenigen Menschen, die Wladimir Putin persönlich kennen. Und Sie sagten in der Vergangenheit, man müsse ihn immer beim Wort nehmen. Wie tickt Russlands Präsident eigentlich?
Krastev
Wenn wir psychologisch argumentieren – was in Wien zugegeben unvermeidbar ist –, sind drei Dinge wichtig: Erstens begreift er bis heute nicht, wie eine Atommacht besiegt werden und zerfallen kann. Zweitens: Ende der 1980er, als sich die UdSSR dramatisch veränderte, war Putin nicht in Russland, sondern in der DDR – er sah die Veränderungen aus der Ferne. Wer Revolutionen aus der Ferne erlebt, kann oft kaum begreifen, was geschieht. Man verlässt ein Land und findet drei, vier Jahre später ein ganz anderes wieder. Diese Unfähigkeit, das Geschehen zu akzeptieren, ist bei Putin zentral. Sie lässt ihn den Zerfall der UdSSR als Verrat von innen begreifen, als dramatische Ungerechtigkeit. Drittens: Er ist überzeugt, der Westen habe die Zerstörung Russlands als Hauptziel. Historisch stimmt das so nicht. Der Westen hat Fehler im Umgang mit Russland gemacht, besonders in den 1990ern. Aber die westliche Politik änderte sich mehrfach. 1991, als die Ukraine über ihre Unabhängigkeit abstimmte, sagte der damalige US-Präsident George Bush in Kyiv: Stimmt nicht für die Unabhängigkeit. Doch Geschichte wird nicht nur von den Reden großer Führer bestimmt. Die Entscheidung über den Zerfall der UdSSR fiel in Moskau, nicht in Washington. Präsident Boris Jelzin und sein Umfeld entschieden – aus technischen und politischen Gründen und wegen der Feindschaft zwischen Jelzin und Gorbatschow –, die UdSSR aufzulösen. Die zentralasiatischen Republiken wurden praktisch aus der Föderation „herausgeworfen“. Gleichzeitig interpretierten viele westliche Analytiker und Politiker das als westlichen Sieg. Es gab große Angst davor, dass das, was in Jugoslawien geschah, auch in der UdSSR passieren könnte. Kurz: Es hätte auch ganz anders laufen können – aber es ist geschehen, was geschehen ist.
Zu Beginn des Ukrainekrieges, als ein Sanktionspaket nach dem anderen geschnürt wurde, dachten viele westliche Politiker, dass Russland dem wirtschaftlichen Druck nicht lange standhalten kann. Haben wir Russland unterschätzt?
Krastev
Erstens zielte die US-Politik darauf ab, Russland stark, aber nicht zu stark zu treffen. Man fürchtete eine Eskalation bis hin zum Einsatz taktischer Nuklearwaffen, besonders im Sommer 2022, als die ukrainische Offensive Fahrt aufnahm und klar wurde, dass Putins „Spezialoperation“ nicht wie gewünscht lief. Zudem wollte man den globalen Ölmarkt nicht destabilisieren – höhere Benzinpreise wären innenpolitisch problematisch für den damaligen US-Präsidenten Joe Biden gewesen. Zweitens war Russland vorbereitet, nämlich seit 2014. Damals hatte Moskau Importverbote auf bestimmte Lebensmittel verhängt, die ökonomisch total absurd wirkten, aber aus einer Kriegslogik heraus sinnvoll waren. Damit stellte Russland Ernährungssouveränität her und produzierte viel mehr selbst. Drittens: der außergewöhnliche Professionalismus der russischen Zentralbank.
Sie meinen finanzpolitische Maßnahmen wie Kapitalverkehrsbeschränkungen, die die Notenbankchefin Elvira Nabiullina getroffen hat?
Krastev
Viele Personen in Russlands wirtschaftlicher Elite waren persönlich gegen den Krieg. Und einige glaubten bis zuletzt nicht daran, dass Russland wirklich in die Ukraine einmarschiert. Aber ihr Handeln half Putin dennoch enorm. Die Notenbankchefin trat nach Kriegsbeginn wochenlang nur in Schwarz gekleidet auf, was als Zeichen ihrer Ablehnung des Krieges gewertet wurde. Trotzdem haben ihre Maßnahmen die russische Wirtschaft massiv stabilisiert. Aber wie sagt man so schön? Das ist nicht mein Krieg, aber es ist mein Land. Etwas, das bei uns weniger bekannt ist, aber den kleineren russischen Unternehmen sehr half: Es gab eine deutliche Liberalisierung nach innen. Steuern und Abgaben wurden weniger streng kontrolliert, Bürokratiebestimmungen wurden abgebaut, es wurden kreative Wege gesucht, die Sanktionen zu umgehen. Hinzu kamen die Hilfen aus China und Indien, das heute der größte Abnehmer von russischem Öl ist.
Kennen Sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj persönlich?
Krastev
Nur flüchtig. Man vergisst, dass er zu denjenigen gehörte, die glaubten, der Krieg werde nicht beginnen – etwas, wofür ihn die Opposition heute noch scharf kritisiert. Als der Krieg tatsächlich begann, lag seine Popularität bei unter 30 Prozent. Aber es gibt manchmal gewisse Schlüsselmomente für ein Volk, die die Geschichte neu schreiben. Ein solcher Moment war, als Selenskyj zu Kriegsbeginn sagte: „Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, sondern Munition.“ Viele Europäer, aber auch die USA, glaubten nicht an die ukrainische Verteidigungsfähigkeit. Die Amerikaner hatten exzellente Informationen über Russlands Pläne, sie erwarteten den Fall Kyivs und danach einen Guerillakrieg. Deshalb schickten die USA anfangs nur begrenzt Waffen – aus Angst, sie könnten Russland in die Hände fallen. Die ukrainische Überraschung traf nicht nur Europa, sondern auch die USA, und in gewissem Umfang die Ukrainer selbst. Das ist der Reiz der Geschichte: Es gibt Momente, in denen eine Gesellschaft sich konsolidiert und neu ordnet.
Denkt Putin noch immer, er könnte eine Nation unterwerfen, die sich seit dreieinhalb Jahren wehrt?
Krastev
Ja, weil nach einer getroffenen Entscheidung viele andere unmöglich werden. Russlands „Spezialoperation“ endete mit der ersten Mobilisierung im September 2022. Seither ist es – in Putins Vorstellung – ein Krieg gegen den Westen. Jede Schwäche Russlands bedroht seine Macht und seine Vorstellung von Russlands Rolle in der Welt. Putin hat nie daran geglaubt, dass etwa Lwiw (Lemberg) russisch sei; vielleicht noch Kyiv, Charkiw. Er sah einen prowestlichen Elitenkern, der die Gesellschaft nicht vertrete. Wenn dieser besiegt sei, werde die Gesellschaft Russlands Vormacht akzeptieren, vielleicht nicht mit Nelken winkend, aber doch. Was er stattdessen bekommen hat, ist die starke Resilienz der Ukraine, die er als Demütigung erlebt. Er ist überzeugt, dass eine souveräne, prowestliche Ukraine eine direkte Bedrohung für Russlands Rolle in der Welt ist. Und was Putin selbst anbelangt: Er sagt immer ziemlich klar, was er tun will.
Was geschieht gerade in Osteuropa? Polen und die Balten rüsten massiv auf und sind stark antirussisch. Dann gibt es Länder wie die Slowakei, Serbien, und teilweise Bulgarien mit einer prorussischen Rhetorik, die trotzdem sehr viel Munition und Waffen an die Ukraine liefern. Und Ungarn setzt sich immer wieder für Russland ein.
Krastev
Staaten, die früher Teil des Russischen Reiches waren (Finnland, Polen, das Baltikum, Anm.), sehen in der Stärke der Ukraine ihren eigenen Schutz, weil sie befürchten, dass sie die Nächsten sein könnten. Die Balkan-Länder haben andere imperiale Erinnerungen. Sie sahen Russland historisch eher als Verbündeten oder Befreier. Ungarn ist nicht klassisch prorussisch, und vielleicht wäre die Haltung unter einer anderen Regierung dort anders. Am Ende geht es um ökonomische Interessen: Die Rüstungsindustrie schafft Jobs. In Bulgarien ist sie gemessen an ihrem Anteil am BIP heute der zweitwichtigste Industriezweig. Der Krieg tötet, aber er schafft auch Arbeitsplätze. Man sollte die Realität nicht zu sehr vereinfachen.
US-Präsident Trump hat den Friedensplan zwischen der Hamas und Israel verhandelt. Er behauptet, auch den Krieg in der Ukraine beenden zu wollen. Dafür will er den Friedensnobelpreis. Verdient er ihn tatsächlich?
Krastev
Trump liebt zwar sich selbst, aber nicht den Krieg. Doch für ihn sind Frieden und Waffenstillstand oft dasselbe. Das Nobelpreiskomitee brachte sich in eine schwierige Lage, als es 2009 dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama den Preis gab, bevor er tatsächlich etwas getan hatte. Im Nahen Osten sehen wir erst den Beginn eines Waffenstillstands, in der Ukraine intensiviert sich der Krieg. Wenn die Aussicht auf einen Preis ein zusätzlicher Anreiz ist, Konflikte zu beenden, dann ist es gut, dass es diesen Preis gibt.
Wie ist das Verhältnis zwischen Putin und Trump heute?
Krastev
Das sind zwei sehr verschiedene Menschen. Der eine ist ein professioneller Offizier, einer, der mit den Schwächen anderer arbeitet. Der andere ist hyperenergetisch, narzisstisch und unfähig, die Welt anders als durch das Verhältnis der Welt zu ihm zu sehen. Aber beide glauben an ihre große historische Rolle. Beide sind in besonderer Weise gekränkt – der eine persönlich, der andere im Namen seines ganzen Landes. Es ist weniger der abstrakte Autoritarismus, der sie eint, als ein geteiltes Gefühl der Beleidigung durch die Welt – das ist ein starker Motivator.
Österreich ist per Verfassung ein neutrales Land, wir haben ein Neutralitätsgesetz und beteiligen uns auch nicht an Waffenlieferungen für die Ukraine. Gleichzeitig tragen wir die EU-Sanktionen mit und verurteilen Russlands Einmarsch. Muss Österreich seine Neutralität überdenken?
Krastev
Österreich ist nur in seiner Selbstwahrnehmung neutral. Das gilt auch für die Schweiz. In einer Welt, in der Konflikte über Sanktionen und Cybersicherheit ausgetragen werden, gibt es im Zustand von „Unpeace“ schlicht keine Neutralität. Die Spielregeln haben sich geändert. Aus innenpolitischen Gründen wird Österreich, anders als Schweden und Finnland, den Neutralitätsstatus wohl behalten. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine oder Russland und dem Westen finden trotzdem nicht wie früher in Wien statt, sondern in den Golfstaaten oder in der Türkei. Neutralität ist immer kontextuell, sie existiert in den Augen der anderen, nicht nur in der eigenen Verfassung.