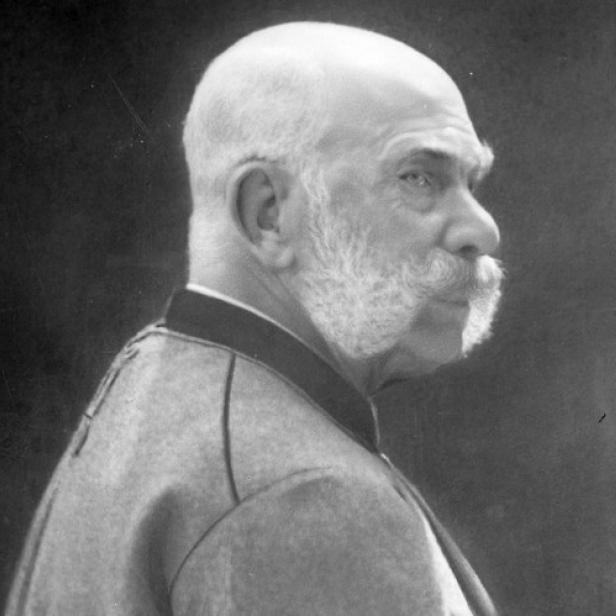DIE ROMANTIKERIN oder „Wie eine arme Hündin“
Tatsächlich heiratete Maria Theresia im Alter von 19 Jahren aus einem in diesen Kreisen höchst unüblichen Motiv den gut aussehenden und neun Jahre älteren Franz Stephan von Lothringen, den sie bereits im Alter von sechs Jahren am Wiener Hof kennen gelernt hatte: „Es war tatsächlich Liebe. In einer Welt, in der es beim Heiraten vor allem um dynastische Strategien ging, sehr ungewöhnlich, nahezu verpönt“, so Katrin Unterreiner. Prinz Eugen hätte sich für die Zweitgeborene von Kaiser Karl VI. und dessen Gemahlin Elisabeth Christine, einer deutschen Prinzessin, einen vom Machtaspekt her gewichtigeren Heiratskandidaten vorgestellt, im Idealfall Friedrich von Preußen. Wie schwärmerisch die Kaiserin ihrem Gemahl zugetan war, ist in zahlreichen Briefzeugnissen dokumentiert. Am 8. Februar 1736, vier Tage vor ihrer Hochzeit, schrieb sie: „Caro viso (Anm.: Geliebtes Antlitz), Ich bin Ihnen unendlich für Ihre Aufmerksamkeit verbunden, denn ich war bekümmert wie eine arme Hündin. Haben Sie mich ein wenig lieb... Adieu Mäusl, ich umarme Sie von ganzem Herzen, schonen Sie sich recht.“
Die Antwortschreiben des „Mäusls“ an seine „Chère Mitz“ waren weitaus stärker einer gefühlsreglementierenden Etikette verpflichtet. Verliebt wie „ein Mädchen aus den mittleren Ständen“ (so die Tochter ihrer Vorleserin) benahm sich die Erzherzogin in ihrer Brautzeit. Der englische Gesandte Thomas Robinson notierte 1735 nahezu besorgt: „Wenn sie am Tag sich auf der Höhe ihrer Seelenstimmung befunden, so seufzt sie des Nachts nur von ihrem Herzog. Wenn sie schläft, träumt sie nur von ihm, wenn sie wacht, so spricht sie mit ihren Hofdamen nur von ihm.“ Tatsächlich soll diese Ehe bis zum letzten Atemzug ihres Gemahls und offiziellen Mitregenten (de facto traf Maria Theresia aber alle Entscheidungen im Alleingang) am 18. August 1765 von unüblicher Zärtlichkeit geprägt gewesen sein. Man teilte sich ein gemeinsames Schlafzimmer, was an anderen europäischen Höfen nicht Usus war. All ihren Kindern riet sie später, in ihren Ehen das Gleiche zu tun.
SEITENSPRÜNGE oder „nie eine Stunde ohne Eifersucht“
Ungeachtet der Prosperität dieser Ehe hatte der in Nancy geborene Franz I. (1745 wurde er zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gekrönt, wodurch der Titel „Kaiserin“ auch für Maria Theresia, davor „nur“ Erzherzogin von Österreich, Königin von Böhmen und Ungarn, legitim wurde) auch Affären, die seiner Gemahlin schwer zu schaffen machten. An ihre Tochter Maria Christine schrieb sie: „Ich habe meinen Gemahl geliebt, wie vielleicht kein Weib je den seinigen; doch war ich immer unglücklich, weil er anderer Frauen bedurfte.“Noch nach Franz’ plötzlichem Tod in Innsbruck 1765 vertraute sie einer Freundin an: „Ich war nie eine Stunde ohne Eifersucht.“
Galante Soupers mit diversen Damen schmiss der abtrünnige Ehemann, der auch ein absolutes Finanzgenie war und ein erhebliches Privatvermögen aufbaute, in Gartenpalais und Lustschlössern in Wien und Umgebung oder auch in der Sommer-Residenz Belvedere. Maria Theresias gefährlichste Rivalin war „la belle princesse“, Maria Wilhelmine von Auersperg, die noch dazu eine ihrer Hofdamen war. Nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern auch wegen ihres Scharfsinns war diese ein strahlender Mittelpunkt bei frivolen Abendgesellschaften, die in jähem Kontrast zur strengen Hofetikette der Habsburger standen. „Außereheliche Amouren waren in der höfischen Gesellschaft durchaus Alltag“, erzählt Unterreiner, „die auch den aristokratischen Damen gegönnt waren. Diesbezüglich gab es keinen Unterschied.“ Allerdings wurde im Fall von Monarchinnen kein Auge zugedrückt: „Das wäre zu gefährlich gewesen, was die spätere Thronfolge betrifft.“ Lustbarkeiten jenseits ihres ehelichen Gemachs fand Maria Theresia im Glücksspiel, besonders in dem für das gemeine Volk verbotenen Kartenspiel Pharao, bei dem mit hohen Geldeinsätzen auf Karten gewettet wurde. Die Monarchin zockte leidenschaftlich, manche Biografen sprechen auch von einer regelrechten Spielsucht. Ihr Faible dafür führte zur Einführung einer öffentlichen Lotterie. Ansonsten linderten gewickelte Krebs-Germnudeln, (Teigschnecken mit einer Krebsfarce) und ihre Leib-Bouillon (Fleischbrühe mit eingerührtem Obers und Kräutern) als „Comfort Food“ ein wenig den Schmerz der erlittenen Untreue.
SCHWANGERSCHAFTEN oder „Wie mich das schwächt“
Maria Theresias Mutter Elisabeth Christine musste einst intensive Rotweinkuren über sich ergehen lassen, erzählt Katrin Unterreiner: „So hoffte man, dass sie noch einen männlichen Nachkommen gebären würde. Aber wahrscheinlich hatte es den gegenteiligen Effekt.“ Ein Jahr vor Maria Theresias Geburt 1717 war ihr Bruder, der erstgeborene Sohn Leopold Johann, im Alter von nur sieben Monaten gestorben. Vorsorglich hatte sich der Kaiser schon 1713 mit Erlass der Pragmatischen Sanktion gewappnet, der Maria Theresia später die Thronfolge ermöglichen sollte. Aus dieser Traumatisierung lässt sich auch erklären, warum Maria Theresia sich auf Gemälden besonders häufig in trauter Familienidylle verewigen ließ, gleichzeitig wollte sie sich mit diesen Inszenierungen aber auch als souveräne Landesmutter darstellen: Insgesamt gebar sie 16 Kinder in einer Zeitspanne von 19 Jahren, wobei drei Mädchen sehr früh starben. Im Spätsommer 1748 schrieb die damals zehnfache Mutter an die Kurfürstin zu Sachsen: „Ich fürchte, ich werde noch mehr Kinder bekommen. ... Denn ich fühle, wie das mich schwächt und mich sehr altern lässt; es würde mich wenig bekümmern, wenn es mich nicht weniger fähig für Kopfarbeiten machte.“
Ihr erstes Kind bekam sie im Alter von 20, ihr letztes mit 39. Von den 16 Kindern des Kaiserpaares erreichten nur zehn das Erwachsenenalter, drei erlagen im Jugendalter den Pocken. Die Kindersterblichkeit wurde als gottgewollt angesehen.
DEPRESSIONEN oder „diese Unlust, zu regieren“
Zahlreiche Briefpassagen zeichnen ein klares Bild: Maria Theresia litt, vom Vater geerbt, an Melancholie, heute würde die Diagnose wohl eindeutig auf Depression lauten. Der damals 26-jährigen Regentin, die offensichtlich häufig über düstere Gedanken klagte, schrieb ihr Berater Emanuel Silva-Tarouca: „Diese Unlust, zu regieren beunruhigt mich ... es ist eine Art periodisch wiederkehrendes Leiden, das alle sechs Monate auftritt ... Eure Majestät stürzen in eine Art Dunkelheit...“ Im fortschreitenden Alter wiederholten sich diese Episoden häufiger, besonders dramatisch wurde es nach dem Tod von Franz Stephan. Die 48-jährige Witwe, die die schwarze Tracht nie wieder ablegen sollte und durch eine Herzschwäche an der Wassersucht litt, flüchtete in die Einsamkeit: „Jetzt bewegt mich nichts mehr. So bleibt nur der Rückzug.“
KONTROLLMUTTER oder „spürbare Kälte“
Nach einer Geburt drückte die Kaiserin in der Regel den Säugling einer Amme zum Stillen in die Hand und ging schon wenig später wieder ihren Regierungsgeschäften nach. Oft arbeitete sie bis zu 15 Stunden am Tag. Das Image der fürsorglichen Mutter, als die sie sich gern inszenierte, entsprach nur bedingt den Tatsachen. Die Kinder wurden von Erziehern, sogenannten Ayas und Ayos betreut, und jeder dieser Kindersitter bekam dicke Anweisungspapiere, fast Betriebsanleitungen, in denen die Mutter Schwächen und Stärken des jeweiligen Kindes hervorhob. Als besonderes Ärgernis empfand sie den Thronfolger, Erzherzog Joseph, der sich als „launisch, zart, unaufmerksam und unvernünftig“ erwies. Das Verhältnis zwischen den beiden sollte bis zu Maria Theresias Tod 1780 höchst problematisch bleiben.
Ihre Schwiegertochter Isabella von Parma, Ehefrau des späteren Kaisers Joseph II., registrierte: „Ihre Liebe ist nie frei von Misstrauen und spürbarer Kälte. Sie geht von einem falschen Grundsatz aus, der in allzu großer Strenge besteht.“
Marie Antoinette, die von ihrer Mutter als vermeintliches Meisterstück ihrer Verheiratungspolitik im Alter von 15 Jahren an den Dauphin nach Frankreich verschachert worden war, erzählte einem Vertrauten von der PR-Strategie ihrer Mutter: „Sobald man von der Ankunft eines Fremden von Bedeutung in Wien Kenntnis erhalten hatte, umgab sich die Kaiserin mit ihrer Familie, zog ihn zur Tafel und erweckte durch diese wohlberechnete Annäherung den Glauben, als leite sie selbst die Erziehung ihrer Kinder.“
Die verstorbene Historikerin und Habsburger-Koryphäe Brigitte Hamann war überzeugt, dass „alle Töchter von klein auf als Werkzeug der Politik betrachtet wurden. Der Machterhalt stand über jeder Form von Mutterliebe. Wichtig war nur, den Umschwung der Bündnisse – weg von England, hin zu Frankreich – zu stabilisieren.“ Ihre Kontroll-Manie behielt sie auch bei, wenn die Töchter längst verheiratet waren. Als die tragische Königin Marie Antoinette 1770 in Frankreich noch immer keine Schwangerschaft vermelden konnte, wurde sie von der Mutter wie folgt abgemahnt: „Die Frau muss sich ihrem Ehemann vor allem unterordnen und hat keine andere Bestimmung im Leben, als ihn glücklich zu machen. Eine gute Ehe hängt immer von der Frau ab – ob sie vergnüglich, zärtlich und amüsant ist.“ Die europabekannte Luxussucht ihrer Tochter quittierte sie mit dem Tadel: „Eine Herrscherin erniedrigt sich, wenn sie sich so herausputzt, und sie erniedrigt sich noch mehr, wenn sie gerade in einer solchen Zeit es zu solchen Ausgaben treibt.“
DIE JUDENFEINDIN oder „keine ärgere Pest“
Die wohl dunkelste und oft verharmloste Facette der Monarchin war ihr tiefer Hass auf die jüdische Bevölkerung. In einem Schreiben an die Hofkanzlei, datiert mit 1777, ordnet Maria Theresia an: „Künftig soll keinem Juden, welchen Namen er haben möge, erlaubt sein, sich hier aufzuhalten, ohne meine schriftliche Erlaubnis. Ich kenne keine ärgere Pest für den Staat als die Nation, wegen der Kunst, durch Betrug, Wucher und Geldvertrag die Leute in den Bettelstand zu bringen, alle übliche Handlung auszuüben, die ein anderer ehrlicher Mann verabscheut. Mithin (sind dieselben) soviel als sein kann, von hier abzuhalten und zu vermindern.“
Der Historiker Karl Vocelka analysiert den Antisemitismus der Herrscherin in einem historischen Kontext: „Ihre Abneigung war religiös motiviert; sie war eine Katholikin der Voraufklärung, geprägt von der Gegenreformation und der Frömmigkeit des Barock: Da war sie unerbittlich konservativ.“ Mit ihren „Judenordnungen“ versuchte sie die Anteile der jüdischen Bevölkerung in Wien gering zu halten, „doch waren die finanzkräftigen Juden unverzichtbar für die Finanzierung ihrer Kriege“, so Katrin Unterreiner. Besonders brutal war Maria Theresia 1744 gegen die größte jüdische Gemeinde ihres Reichs vorgegangen: Wegen des Verdachts der Spionage für Preußen wurden 20.000 Prager Juden ihrer Stadt verwiesen, was zu einem wirtschaftlichen Desaster führte. Als eines der angesehensten Mitglieder der Gemeinde bei der grausamen Monarchin um eine Audienz bat, wurde ihm diese zwar gewährt, allerdings ließ sie zwischen sich und dem Bittsteller einen Paravent aufstellen, da sie Salomon Koreff nicht ins Gesicht sehen wollte.
Gegen Erstattung der sogenannten „böhmischen Judensteuer“ wurde wohlhabenden Mitgliedern später eine Rückkehr ins Ghetto erlaubt. Schikanen der Judenverordnungen waren unter anderem, dass die unverheirateten Männer und Frauen in Böhmen ein gelbes Rechteck auf der Kleidung zu tragen hatten, eine Demütigungsstrategie, von der sich offenbar auch die Nazis inspirieren ließen. Männer mussten Bärte tragen, im Falle einer Rasur wurden sie „am Leibe gestrafet“. Im Falle einer Wiederholung drohte ihnen sogar die Landesverweisung. Erst ihr Sohn Joseph, stark vom Gedankengut der Aufklärung geprägt und im konstanten Clinch mit der reformbehäbigen und unerbittlich erzkatholischen Mutter, beendete diese demütigenden Verordnungen.