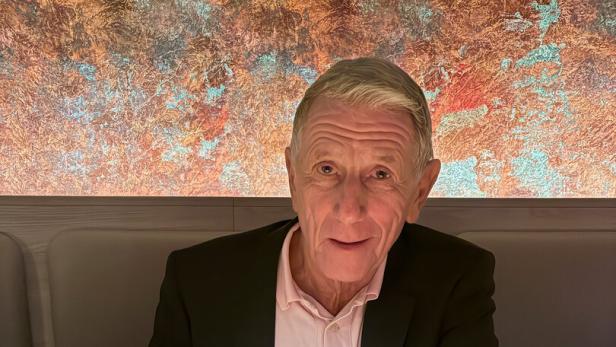Peter Hochegger hat mit seiner PR-Agentur zu Beginn dieses Jahrtausends ein Vermögen gemacht. 40 bis 45 Millionen Euro sollen es am Ende gewesen sein, er selbst kann sich gar nicht mehr erinnern. 15.000 Euro habe er sich Anfang der 2000er-Jahre pro Monat sicher ausbezahlt, sagt er, dazu kam dann die Gewinnausschüttung am Ende des Jahres. Doch dieses Geld ist nach mehreren Prozessen und Verurteilungen weg, 2020 hat Hochegger Privatkonkurs angemeldet, seither wird er aufs Existenzminimum gepfändet und lebt von 1150 Euro im Monat. „Besitz belastet“, sagt Hochegger dazu: „Ich bin heute sicher glücklicher als früher.“ Die etwas mehr als fünf Monate, die er 2016 wegen seiner Beteiligung in der Telekom-Affäre in Haft verbrachte, hätten ihn verändert. „Niemand geht gerne ins Gefängnis“, sagt er, aber tatsächlich habe er die Zeit damals genutzt, um über seine Rolle nachzudenken: „Meine Tochter sagt immer: ‚Gut, dass das alles passiert ist. Jetzt bist du wenigstens wieder ansprechbar. Früher warst du ein richtiges Arschloch, das bist du jetzt nicht mehr.‘“
Geld brauche er jedenfalls keines mehr, sagt Hochegger, als ich ihn frage, wovon er denn lebt. Mit den 1150 Euro kommt er aus, schließlich lebt er die meiste Zeit in Brasilien, und dort ist alles billiger. Wenn er mal mehr braucht, dann hat er Freunde, die ihm etwas borgen. Geld für Flugtickets zum Beispiel. Dann und wann ein Auto. Und wenn er längere Zeit in Österreich ist, dann wohnt er im Hotel eines Freundes, für den er dafür in der Nacht das Telefon abhebt, falls jemand anruft.
Hochegger hatte schon in seiner aktiven Zeit ein Netz von guten Freunden, und offenbar hält das auch in schlechteren Tagen. Wobei, vielleicht ist das nicht ganz unlogisch.
Es ist ein Donnerstag, kurz nach 18 Uhr, und als ich das Lokal betrete, sitzt der einstmals wichtigste PR-Mensch des Landes schon ganz hinten in der letzten Ecke. Er hatte das „Pho Saigon“ vorgeschlagen, weil er sich seit geraumer Zeit nur noch vegetarisch ernährt, und das geht in Asia-Lokalen am besten, meint er. Auch die eher ungewöhnliche Uhrzeit kam von ihm: Der trotz seiner 76 Jahre noch sehr asketisch wirkende Hochegger isst nur noch eine Mahlzeit am Tag, und 18 Uhr sei dafür die beste Zeit. Ich denke kurz darüber nach, ob das vielleicht eine Vorbereitung auf den nächsten Haftantritt ist (in Justizanstalten wird das Abendessen um 17 Uhr ausgegeben), verwerfe den Gedanken aber gleich wieder. Hochegger hat zwar in der Buwog-Causa nochmals eine unbedingte Strafe ausgefasst, die wird er aber wohl nicht im Gefängnis, sondern mit einer Fußfessel absitzen.
„Ich war einfach gierig, ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, was erlaubt ist und was nicht, ich habe es einfach gemacht“, sagt Hochegger, als ich von ihm wissen will, warum er in den frühen Nullerjahren bei so vielen Schweinereien mitgemacht hat. Hochegger war damals eine der zentralen Figuren, wenn es darum ging, wie Firmen Politiker bestechen oder ihnen nahestehenden Vereinen eine kleine Freude machen konnten. Vor allem aber war er mit Walter Meischberger befreundet und dementsprechend erste Reihe fußfrei dabei, als Meischberger und dessen Freund Karl-Heinz Grasser bei der Privatisierung der Buwog mitverdienen wollten. Offiziell war er damals einfach PR-Berater, im Hintergrund war er aber vor allem Strippenzieher und derjenige, der die Überweisungen tätigte, die eine Firma mit einem gewissen Renommee nicht machen sollte.
Heute distanziert sich Peter Hochegger von seinen „Fehlern von damals“. Und wie er sich davon distanziert: Seit ein paar Monaten redet Hochegger gerne und oft über die Korruption in Österreich und seinen Beitrag dazu. Den Anfang machte ein Interview im „Falter“ im April, danach tingelte Hochegger durch die diversen Fernsehsender, dieser Tage erschien bei „edition a“ auch noch ein Buch: „Die Schattenrepublik. Ein Lobbyist packt aus“. Und alle, die nach den 280 Seiten nicht genug von der Hochegger-Story haben, können sich einen neuen Podcast anhören, in dem Hochegger in unfassbaren acht Folgen mit dem Investigativjournalisten Michael Nikbakhsh über die Korruption in dieser Republik redet. Das Ganze gibt’s dann auch noch live in der „Kulisse“ zu sehen. Die Hochegger Beichte vor Publikum verkauft sich so gut, dass mittlerweile sieben Zusatztermine Ende Oktober ins Programm genommen wurden. Warum funktioniert diese Hochegger-Vermarktungskette eigentlich so gut? Ganz offenbar hören die Menschen gern True-Crime-Geschichten. Vor allem, wenn sie launig erzählt werden und im Mittelpunkt ein gefallener Held steht, der Reue zeigt.
Tatsächlich ist sein Buch flott geschrieben, auch die Podcast-Serie ist nicht ganz unwitzig. Er enthüllt darin zwar nichts Neues, er erzählt aber sehr charmant und sympathisch, genau so, wie er mir jetzt im „Pho Saigon“ gegenübersitzt. Auch hier malt er ein sehr stimmiges Sittenbild eines Landes, in dem sich jeder bedient, sobald er die Möglichkeit dazu hat. Seine eigene Rolle schrumpft dabei, je länger man ihm zuhört, immer weiter, und irgendwann hat man das Gefühl, dass dieser Hochegger einfach nur ein gewitzter Lausbub war. Jemand, der ein paar Bubenstreiche gespielt hat, auch wenn die vielleicht etwas lukrativer waren, als wenn er hinter dem Supermarkt Pfandflaschen gemopst und sie im Supermarkt zurückgegeben hätte. In seiner besten Zeit hat Hochegger zum Beispiel den ÖBB die Markenrechte am Namen „Railjet“ um 180.000 Euro verkauft, dabei war dieser Name einem ÖBB-Mitarbeiter in einem Hochegger-Workshop eingefallen. Aber wen kümmert das heute?
An der aktuellen Verwertung seiner Geschichte verdient Hochegger nichts. Die Einnahmen aus seinem Buch gehen an seine Cousine, die ihm in den vergangenen Jahren finanziell immer wieder ausgeholfen hat. Hochegger schuldet ihr laut eigener Auskunft einen mittleren siebenstelligen Betrag. Wie das juristisch funktioniert, obwohl die Republik eigentlich einen Pfändungstitel gegen ihn hat, verstehe ich nicht. Aber es ist in jedem Fall gut, wenn man eine Cousine hat, die einem ein paar Millionen Euro borgen kann.
Wobei man sie auch nicht überbeanspruchen sollte. Das Essen zahle also besser ich.