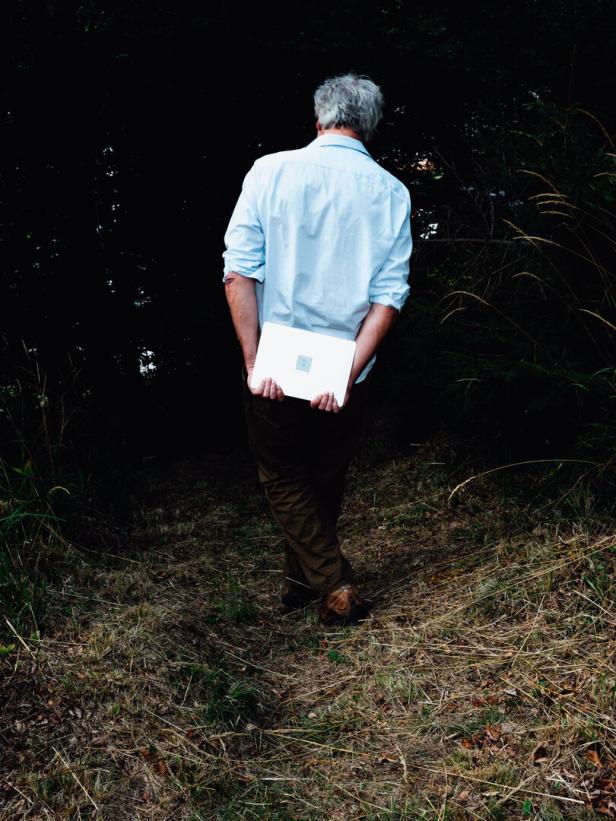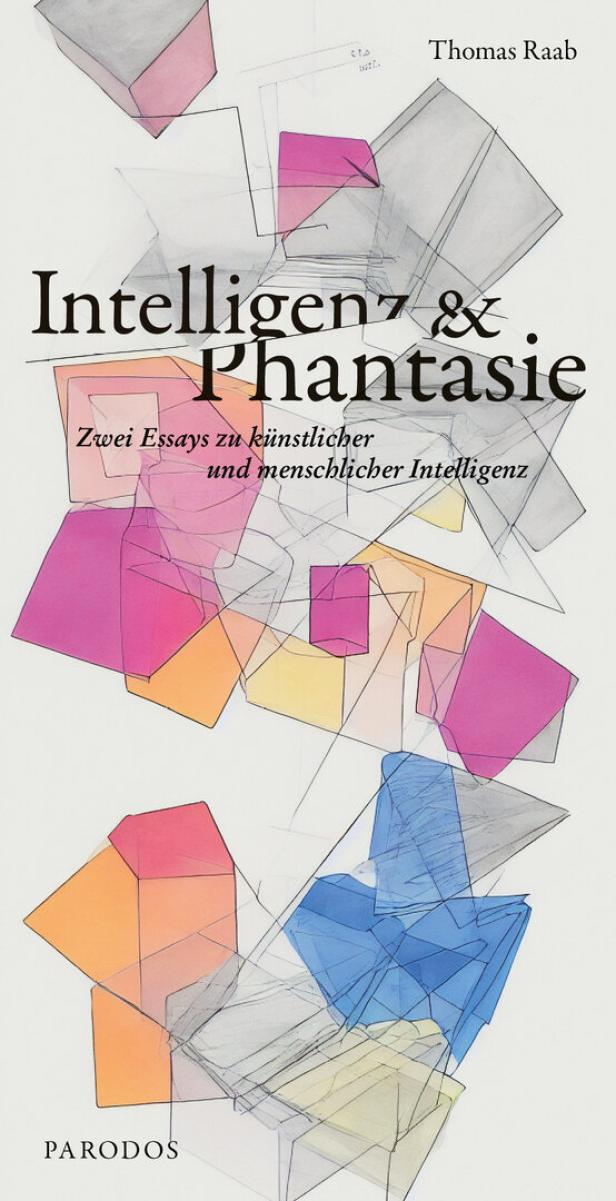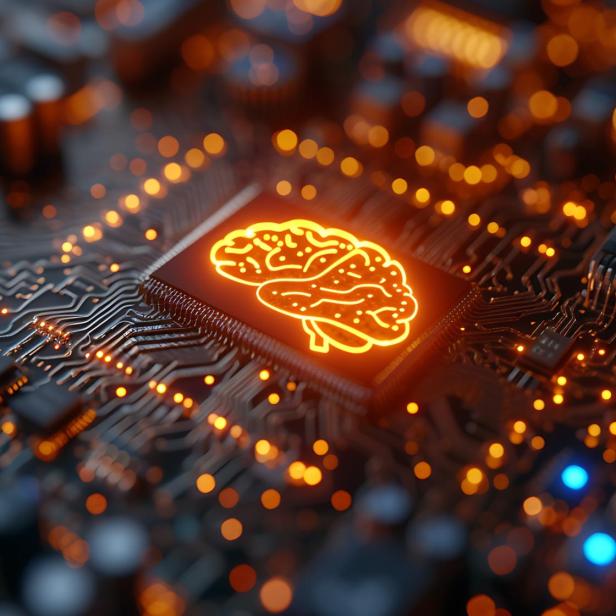Kann das Misstrauen gegen eine Welt, in der keinem Bild und keinem Ton mehr zu trauen ist, nicht unsere gesamte Weltwahrnehmung ruinieren?
Raab
Hat es ja schon. Dazu hat es aber keine generative KI gebraucht. Es ist klar, dass Schüler, die nichts mehr selbst schreiben, auch nichts mehr erkennen können, und dann gerät man in so eine Art Idiotenkreislauf. An der Uni gehe ich zum Beispiel davon aus, dass die Studierenden etwas lernen wollen. Warum sitzen die sonst dort rum?
Um möglichst unaufwändig einen Titel zu kriegen?
Raab
Hier liegt das Problem. Man braucht den Titel, weil er bürokratisch nötig ist. Als ich einst Technische Geologie studiert habe, gab es da sechs Studienrichtungen. Inzwischen gibt es 50. Die heißen dann etwa „Umweltsystemwissenschaften“ oder „Klimatologie 2“. Wie soll ein 18-Jähriger sich dort orientieren? Man hat eine gigantische Spezialisierung etabliert, generiert dort Doktoren, aber am Ende sitzen alle vor den Computern und machen dasselbe. Das ist absurd. Wir haben alle mehr oder weniger denselben Beruf. Wir wischen alle auf Geräten rum, müssen Informationen einordnen und dann einen kleinen Bericht darüber verfassen.
Es gibt schon auch Leute, die Straßen asphaltieren oder Gärten gestalten.
Raab
Aber selbst, wenn man beim Billa arbeitet, muss man relativ viele komplizierte Formulare ausfüllen. Es ist halt traurig: Die Tertiärausbildung wäre viel produktiver, wenn die Leute lernen wollten und man sie nicht dazu zwänge. Das Oktroyieren von oben vergisst, dass kein Mensch Autorität wirklich akzeptiert. Jeder will sich als selbsthandelnd begreifen. Ein Mensch, der zu 100 Prozent überzeugt Ja zu den Anordnungen einer Autorität sagte, würde in der Psychiatrie landen.
Menschen sind doch durchaus geneigt, sich Stärkeren unterzuordnen. Der Nationalsozialismus ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass Unterordnung leider bestens funktioniert.
Raab
Ja, aber es bleibt ein Rest. Wenn ich weiß, dass morgen die Gestapo vor meiner Tür stehen wird, wenn ich nicht aufhöre, über solche Sachen nachzudenken, höre ich natürlich damit auf. Aber es wird ein Rest an Widerstand bleiben. Edgar Allan Poe hat diese innere asoziale Stimme den „Daimon“ genannt. Bei Poe gibt es die Geschichte des Selbstmörders, der an der Klippe steht und sich überlegt, ob er springen soll. Er geht alle Argumente durch – und findet keinen einzigen Grund zu springen. Es wäre für seine Frau, für sein Kind grauenhaft. Ihm selbst bringt es auch nichts, weil er ohnehin Nihilist ist. Und er springt trotzdem. Man verhält sich selbsthandelnd und damit oft asozial, weil man es eben kann. Obwohl – oder weil – die anderen sagen, das kannst du nicht machen. Da kommt diese merkwürdige Selbstbehauptung des Menschen ins Spiel. Das Freiheitsgefühl.
Die Wissenschaft kann der Befreiung nicht dienen?
Raab
Die modernen Wissenschaften gibt es erst seit 200 Jahren. In nur sieben Generationen soll so unglaublich viel weitergegangen sein? Wir haben in Technik, Produktivität und Medizin erstaunliche Fortschritte gemacht. Aber die Zeit des Wissenschaftsoptimismus geht gerade zu Ende. Vielleicht sollte man die KI-Debatte unter diesem Aspekt sehen: als ein letztes Aufwallen von Wissenschaftseuphorie, während in der Klimaabteilung das Gegenteil passiert.
Sie schreiben, dass der Siegeszug der KI auch stattgefunden habe, weil sie eine leichter zu akzeptierende Autorität sei als reale Vorgesetzte. Warum eigentlich?
Raab
Die Maschine hat keinen Autor. Wenn ich etwas sage, hat es weniger Gewicht als dieselbe Information auf Wikipedia – weil ich ein Mensch bin. Die Maschine ist anonym. Wenn ein Mensch etwas behauptet, hat man das Gefühl, man unterwirft sich ihm. Der Maschine unterwirft man sich nicht. Es ist aber de facto dasselbe, weil ChatGPT ja auch eine Autorität ist. Sie hat nur keinen Autor. Das ist offenbar viel angenehmer für die meisten Menschen.
Ein wissenswerter Text ist ein Chef ohne Eigenschaften. Er hat kein Gesicht und keine besonderen Merkmale.
Raab
Ja, einen Chef ohne Eigenschaften wünschen wir uns alle.
Könnte eine KI, die ja bislang nur bestehendes Wissen remixen kann, gefährlich werden, wenn sie wirklich Neues herstellen könnte? Oder Gedanken, die noch nicht gedacht wurden, denken könnte?
Raab
Wer denkt schon Gedanken, die noch nie gedacht wurden?
Wir nicht, aber vielleicht kann das die Maschine irgendwann.
Raab
Ich weiß es nicht. Das Wort neu ist natürlich philosophisch belastet. Es stinkt. Wenn es mir beispielsweise gelingt, die spezielle Relativitätstheorie zu verstehen, ist dieses Verständnis für mich neu. Ich habe also de facto dieselbe neue Erkenntnis wie der Kollege Einstein. Nur hat er sie halt als erster gehabt. Die Frage ist aber: Wenn Einstein diese Erkenntnis nicht gehabt hätte, wäre sie dann nie da gewesen? Das wird gern impliziert. Dahinter steckt die Idee des Genies, des Stars. Es ist aber absurd zu glauben, dass es die Relativitätstheorie, wenn Einstein nicht gewesen wäre, nie gegeben hätte. Sie lag in der Luft, weil die Vorbedingungen, alle Elemente schon da waren – es musste „nur“ ein richtiger Zusammenhang hergestellt werden. Ich glaube, dass es das Neue im strengen Sinn überhaupt nicht gibt. Alles ist schon da, und irgendwer stolpert darüber.
Man findet etwas, weil es auf der Straße liegt. Man muss es nur wahrnehmen.
Raab
Man muss das Problem sehen. Der Mensch ist kein Problemlöser. Er ist Problemfinder. Damit ist die Menschenähnlichkeit des Phänomens Künstliche Intelligenz auch schon erledigt. Denn die KI löst vordefinierte Probleme. Die Vorstellung, dass eine Maschine Probleme finden sollte, ist komisch.
KI-Kunst ist ein interessantes Feld. Will ich eine Ausstellung von KI-generierter Malerei sehen? Kann ich einen geprompteten Popsong gut finden?
Raab
Aber maschinelle Musik wie Techno gibt es seit Jahrzehnten, und das Entmenschlichte führte gerade zur Lust daran.
Das geht noch weiter zurück. Schon die in den 1950er- und 1960er-Jahren entwickelte Computer- und Konzeptkunst setzte auf Zufallsergebnisse. Das war aber eben die Avantgarde; die zufälligen Kompositionen der KI sind heute Mainstream, und dann wird es langweilig.
Raab
Es war schon vorher langweilig. Man darf nicht vergessen, wie unheimlich fad die Avantgarde oft war. Vor allem die Formalisierungen sind unglaublich öde. Andy Warhol hat seine Art von Kunst auch nur gemacht, weil er es konnte. Die anderen sagten, man könne Bilder doch nicht einfach an der Siebdruckmaschine vervielfältigen, aber Warhol sagte, doch, ich mache es ja gerade, und es verkauft sich bestens.
Deshalb gehört Warhol zu den faszinierendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts: weil es ein Mensch ist, der eine so irre maschinelle Idee hat. Vielleicht ist es so: Man kann Menschen bewundern, die sich wie Maschinen benehmen, aber nicht Maschinen, die sich wie Menschen gerieren?
Raab
Das kann gut sein. Für mich ist Andy Warhol einer der ödesten Künstler überhaupt. Ungeachtet der Dinge, die er erfunden haben mag, ist sein Witz sehr dünn. Ich meine, ich muss auch lachen, wenn ich „Die Philosophie des Andy Warhol von A bis B und zurück“ lese. Das ist goschert geschrieben und als Literatur total in Ordnung. Aber eine Schwierigkeit der Kunst ist, dass es keine Kriterien für sie gibt. Man muss es tautologisch sagen: Gute Kunst setzt sich durch, weil sie sich durchsetzt. In dieser Durchsetzungsfähigkeit liegt das Rätsel. Der Zeitgeist ist ja sehr fragil, man weiß nie, was der nächste heiße Scheiß sein wird. Für mich steht Kunst eher in der Nachfolge der Religion. Sie hat eine rituelle Funktion, eine soziale Statusfunktion. Denn nutzloses Wissen ist für den Status sehr wichtig. Wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, wer Andy Warhol ist, wäre ich ordentlich blamiert gewesen. So gesehen ist es doch notwendiges Wissen, Herrschaftswissen eigentlich.
Als Autor und Übersetzer sind Sie selbst direkt betroffen von der KI-Revolution. Der soziale und geschäftliche Wert eines Texts ist auf einen einsamen Tiefstand gesunken. Betrauern Sie das nicht?
Raab
Doch, natürlich. Aber wer bin ich, der ich gegen den Strom schwimmen wollte?
Meinen Sie, es wird hingenommen werden, dass in Zeitungen Dinge stehen, die kein Mensch mehr geschrieben hat?
Raab
Es ist anders: Sie müssen akzeptieren, dass schon jetzt niemand mehr liest, was die Menschen schreiben. Ich glaube, dass es auf der Nachfrageseite düster aussieht; es ist geradezu ironisch, dass man in einer Zeit der Überproduktion gerade die Überproduktion bürokratisch verbessert.
Trotz dieser Krisensymptome gibt es ja weiterhin Zeitungen, Verlage und Bücher. Obwohl niemand mehr liest?
Raab
Die bürgerliche Herrschaftsform kommt offensichtlich an ein Ende. Die Bücher sind ja nicht nur deswegen nichts mehr wert, weil die Leute sie nicht lesen, sondern die Leute lesen sie nicht, weil sie damit keine Punkte machen können. Und das können sie deshalb nicht, weil der Kern, der Glaube an die gemeinsame Utopie, die diese aufgeklärte bürgerliche Demokratie war, schon zerbrochen ist. Die Frage ist eher: Wird eine verteilte, eine den Menschen Freiraum gebende Gesellschaft kommen – oder eine total kontrollierte, über Computer verwaltete Gesellschaft? Aber egal, wie es ausgeht: Die Helden, die Stars und die Genies werden andere sein.
Die meisten von uns interessieren sich für ganz bestimmte Dinge, die wir dann sehr aufmerksam lesen. Das könnte sein, was bleibt: spezialisiertes Wissen für spezialisierte Menschen.
Raab
Ja, das Wissen der Bubbles. Wir alle hängen immer abgeschotteter in unseren Interessens-Affinity-Groups, zwischen denen kaum noch vermittelt werden kann. Es wird spezialisierter. Denn es fehlt der gemeinsame, sozusagen ideelle Kern. Heute sammelt niemand mehr Briefmarken – Serienschauen ist das neue Briefmarkensammeln. Die Mikrodifferenzierung zwischen den einzelnen Episoden gibt Sicherheit, man wird Spezialist in einer Sache.
Vielleicht auch, um sich mit dem Niedergang der Demokratie nicht näher befassen zu müssen?
Raab
Wohin der Optimismus verschwunden ist, frage ich mich schon. Auch die Jungen sind so pessimistisch. Das schmerzt mich sehr. Wir hätten in den 1980er- und 1990er-Jahren alle Gründe gehabt, Angst zu haben, keine Jobs zu kriegen. Aber erst jetzt, wo jeder Einzelne gebraucht wird, herrscht dieser unglaubliche Pessimismus. Aber KI ist eine Art Nischenverstärker. Sie reproduziert das Nischenwissen, das es schon gibt. So wird es immer schwieriger, Mehrheiten zu bilden, gemeinschaftliche Projekte auf die Reihe zu kriegen.
Lieber feiert jede soziale Subgruppe ihre Feindschaft zu anderen Subgruppen. Wenn man versucht, ein Interesse zu entwickeln für Dinge außerhalb der eigenen Blase, wird es schwierig. Weil es so verwirrend viel von allem gibt. Aufgrund dieser Konfusion muss ich vielleicht Feindschaften bilden, um wieder klarere Grenzen zu ziehen.
Raab
Das ist die Merkwürdigkeit unserer Generation. Als wir jung waren, wollten wir vor den Autoritäten nicht mehr knien. Wenn ein Lehrer an unserer Schule autoritär war, wurde er ausgelacht. Der Direktor maßregelte uns 1987 und verwendete dabei das Wort „Anstand“. Dann haben wir nachgedacht, was er damit meinen könnte. Das muss ein Wort gewesen sein, das noch zehn Jahre vorher irgendeine Bedeutung gehabt hatte. Er hat wohl so etwas wie „bürgerliche Sitte“ gemeint. Eine verbindliche Sitte gab’s aber schon nicht mehr. Daher wollten wir nicht mehr knien, auch nicht vor der Kritik, vor Figuren wie Marcel Reich-Ranicki. Solche Autoritäten sind folglich verschwunden. Wenn heute ein Literaturkritiker jemandem Genialität attestiert, hat er nur eine Meinung. Auch an den Universitäten gibt es den Professor nicht mehr, der etwas sagt, das dann gelten würde. Das wollten wir so. Und jetzt, da wir es haben, passt es uns wieder nicht. Jetzt sind wir sauer darüber, dass wir uns den Weg durchs Informationsdickicht selbst bahnen müssen.
KI ist scheinbar sehr niederschwellig. Open AI heißt programmatisch einer der zentralen Konzerne. Droht die KI, wenn wir sie demnächst alle brauchen werden, nicht plötzlich sehr teuer und damit ein Instrument der Eliten zu werden?
Raab
Warum sollten wir sie brauchen?
Die Konzerne legen es doch darauf an, dass wir uns an sie binden, dass wir KI zu einem alltäglichen Instrument machen, es für alles benutzen.
Raab
Aber für alle Dinge, die mich interessen, kann ich sie nicht brauchen. Texte zu produzieren ist doch das eigentlich Lustvolle. Für die Pflicht, den Ausfluss dann zehnmal durchzulesen und zu korrigieren, hätte ich gerne jemanden, der das für mich macht.
Beauftragen Sie doch die KI damit.
Raab
Sie kann es aber nicht, weil sich meine Orientierung jedes Mal, wenn ich einen Korrekturlauf mache, leicht ändert. Ich schreibe etwas Neues dazu, nehme anderes raus. Die Korrekturläufe enden nie.
Stimmt, jedes Ende ist willkürlich.
Raab
Ich würde jeden Text am nächsten Tag wieder anders schreiben. Denn meine Orientierung und Perspektive haben sich verändert. Andere Dinge treten in den Vordergrund. Und dafür nützt mir der Chatbot nichts. Die Bürokratie hat sich mit der KI selbst ein Ei gelegt. Die meisten Probleme haben nun die Unis, aber da habe ich keine Gnade. Wenn sie über Jahrzehnte Leute ausbilden, die nur Formulare ausfüllen, und dann wird eine Maschine mit diesen Daten programmiert, die solche Formulare auch ausfüllen kann, sind sie selber schuld. Mit der Bürokratie habe ich kein Mitleid. Und Menschen, die nachdenken, wird es immer geben. Weil es eben befriedigend ist und das Schreiben mir auch hilft, in vielem klarer zu werden. Das Schreiben selbst ist ja überhaupt kein Problem. Das Problem ist das Denken. Insofern schrammt die KI an der Sache vorbei. Die KI denkt nicht. Es geht aber ums Denken. Und das ist unverstanden. Daher mache ich mir keine Sorgen. Dinge, die man nicht überdenken muss, werden automatisiert. Ich bin froh, wenn die Billa-Maschine die Bierflaschen selbstständig ansaugt. Genauso werde ich froh sein, wenn alltägliche Demokratieabläufe von Maschinen erledigt werden – und ich das nicht mehr machen muss. Aber die Sachen, die mich und Sie interessieren, kann KI nicht: Wenn Sie recherchieren, wirkliche Fakten, die nicht im Internet zu finden sind, werden Sie mit der KI nicht weit kommen. Sie kann nur viel neue Freizeit schaffen.
Die Hölle der ewigen Freizeit und der never ending shopping tour.
Raab
Ich dachte immer, darauf würden sich alle freuen. Endlich könnten alle Künstler werden, und Joseph Beuys hätte recht behalten. Aber die Leute hängen an ihren Jobs. Freizeit ist ein enormes Problem. Die Langeweile ist wohl unser wirkliches Epochenproblem.