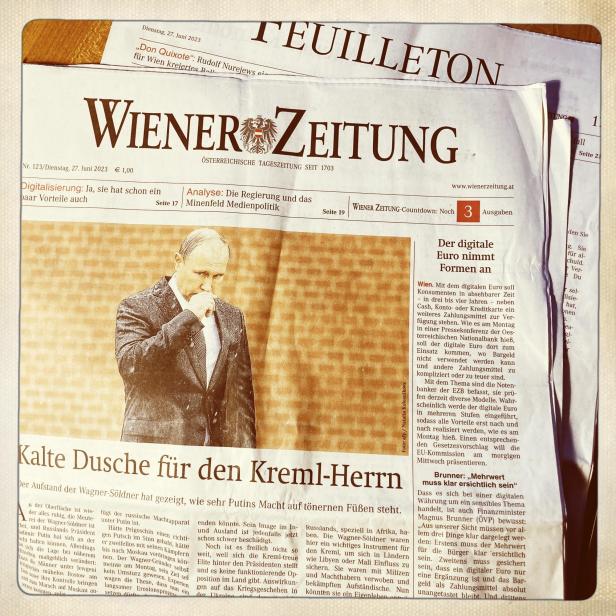Von Print zum Kompass
Vor zwei Jahren hatten ÖVP und Grüne beschlossen, die älteste gedruckte Zeitung der Welt einzustampfen. Die Pflichteinschaltungen darin waren vor allem der Wirtschaft ein Dorn im Auge gewesen. Um sich vor dem Vorwurf zu schützen, die Politik würde ein journalistisches Produkt eliminieren, wurde die „Wiener Zeitung“ digital am Leben erhalten: Die Firmengruppe der „Wiener Zeitung“ betreibt die Content-Agentur und diverse Online-Plattformen des Bundes (etwa „Auftrag.at“ für öffentliche Ausschreibungen) sowie einen Media Hub, der unter anderem ein Stipendium zur Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten finanziert. Doch nach außen wirkt weiter vor allem die „Wiener Zeitung“ als journalistisches Online-Angebot mit vereinzelten Magazinausgaben. Der gesetzliche Auftrag für das „Kompassmedium“ in Staatseigentum ist unklar, im Regierungsprogramm wird die „Wiener Zeitung“ nicht einmal erwähnt.
Zu allem Überdruss entdeckte die „Wiener Zeitung“, als sie 2023 im Zuge der Umstellung den Sozialplan für den Abbau zahlreicher Arbeitsplätze berechnete, „dass es offenbar in den Vorjahrzehnten zu Eingabefehlern im Lohnverrechnungssystem kam“, wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigt. Dies habe „zahlreiche Folgefehler“ nach sich gezogen, die seither mit Wirtschaftsprüfern von Deloitte aufgearbeitet werden: Die „Wiener Zeitung“ spricht von einem „riesigen Umfang“, weil die Gehälter aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau nachgerechnet werden müssten. Das betreffe auch ehemalige Angestellte. Dass Paul Vécsei als Behindertenvertrauensperson noch nicht die von ihm erforderte Einsicht bekommen habe, liege schlicht daran, dass das Projekt noch nicht abgeschlossen sei.
Dazu kommt: Das Firmenkonstrukt der „Wiener Zeitung“ muss nun mit fünf Millionen Euro pro Jahr weniger vom Staat auskommen, profil berichtete. Das entstehende finanzielle Delta darf dank Medienminister Andreas Babler (SPÖ) durch die Auflösung von Rücklagen ausgeglichen werden. Denn als die „Wiener Zeitung“ noch gedruckt mit Pflichtinseraten erschien, machte sie Gewinne. Ende 2023 besaß die „Wiener Zeitung GmbH“ daher laut Firmenbuch 22,38 Millionen Euro an Rücklagen. Dazu kommen 6,48 Millionen Euro an Rücklagen in der Tochterfirma „Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH“. Insgesamt könnte die „Wiener Zeitung“ demnach auf fast 29 Millionen Euro zugreifen. Die Jahresabschlüsse für das Jahr 2024 waren zu Redaktionsschluss noch nicht im Firmenbuch abrufbar.
Was mit dem Geld passiert, interessiert auch die FPÖ. In einer parlamentarischen Anfrage an Medienminister Babler will FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker wissen, wer auf die Rücklagen zugreifen kann, wie viel bereits aufgelöst wurde und zu welchem Zweck. Dazu erfragt Hafenecker, wie hoch die monatlichen Zugriffszahlen des Mediums sind. Denn anders als die meisten seriösen Medien lässt die neue „Wiener Zeitung“ ihre Online-Zugriffszahlen nicht von der Österreichischen Web-Analyse (ÖWA) erheben. Immerhin: Der Aufsichtsrat der „Wiener Zeitung“ empfiehlt in seinem aktuellen Evaluierungsbericht zwei Jahre nach der Neuaufstellung, „Überlegungen zur Wirkungsmessung eines öffentlich-rechtlichen Mediums unter Beachtung des Public-Value-Ansatzes zu definieren und schriftlich auszuarbeiten“.
Digitale Werbung
Viel detaillierter für die Vorgänge in der „Wiener Zeitung“ interessiert sich die NGO „Reporter ohne Grenzen“ (ROG). Die Organisation hat der staatlichen Firmengruppe eine umfassende Anfrage nach dem neuen Informationsfreiheitsgesetz gestellt – und will neben den Zugriffszahlen etwa auch die genauen Werbeausgaben des Mediums wissen. „Wir wollen, dass in der ‚Wiener Zeitung‘ Journalismus im besten Sinne gemacht werden kann und die Strukturen gegen politische Zugriffe – egal von welcher Seite – geschützt sind“, erklärt Fritz Hausjell, Präsident von ROG Österreich, die Anfrage: Öffentlich-rechtliche Medien müssten „auch Kickl-resistent sein“.
Zwar sei ihm kein aktueller Fall einer politischen Intervention in die journalistische Arbeit der „Wiener Zeitung“ bekannt, doch: „Die Gesamtkonstruktion wurde nicht so gemacht, wie man sie im Sinne der Stärkung der Pressefreiheit hätte machen sollen.“ Das habe ROG bereits bei der Konzeption der neuen „Wiener Zeitung“ kritisiert, daher wäre es inkonsequent, nun nicht genau hinzuschauen, so Hausjell.
Bekannt ist, dass die „Wiener Zeitung“ zumindest auf Social Media großzügig wirbt: Laut Meta-Werbebericht gab die „Wiener Zeitung“ bisher fast 300.000 Euro für die Bewerbung von rund 1400 Beiträgen auf Facebook und Instagram aus. 29 Beiträge wurden demnach noch in der Zeit der gedruckten Zeitung beworben, die restliche Social-Media-Werbung wurde nach dem 1. Juli 2023 geschaltet.
„Wer heute ein Medium für junge Menschen aufbaut, kann sich nicht auf organische Reichweite allein verlassen“, erklärte Markus Graf, Chief Commercial Officer bei der „Mediengruppe Wiener Zeitung“, gegenüber profil bereits im Juli: Ohne gezielte Bewerbung journalistischer Inhalte sei bei jungen Menschen keine relevante Sichtbarkeit zu erzielen. Ob und wie sich die gekürzten Budgetmittel auf das Werbevolumen der „Wiener Zeitung“ auswirken, beantwortet die Mediengruppe nicht.
Neben alledem prüft der Rechnungshof die „Wiener Zeitung“ seit Monaten. Womöglich interessiert er sich auch dafür, warum das staatliche Unternehmen Paul Vécsei mehr als 6000 Euro nachzahlen muss – und was es seinen anderen aktiven und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldet.