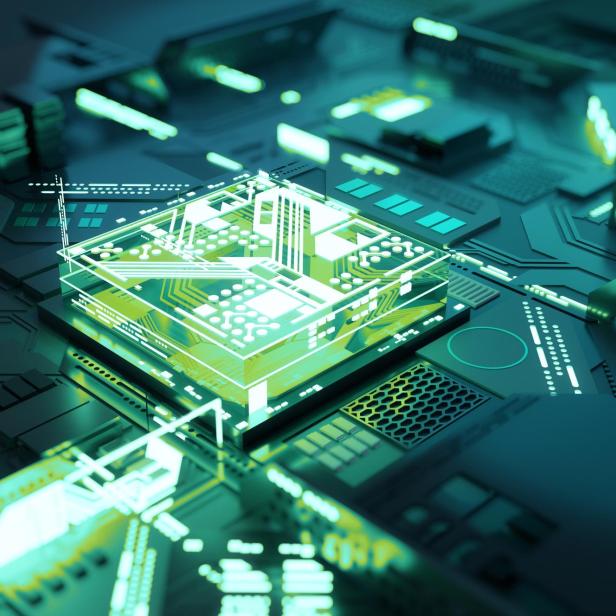Ja sagen zu Österreich
Es war ein LinkedIn-Posting wie vermeintlich jedes andere. „Ich freue mich, mitteilen zu dürfen, dass ich eine neue Position als Head of AI Driven Lab Robotics im Aithyra Research Institute antrete“, schrieb der Biotechniker Wali Malik aus Boston im August in seinem Feed. Die trockene Nachricht an seine knapp 2.000 Follower:innen markiert aber eine Zeitenwende. Malik war der offiziell erste US-Forscher, der, Zitat, „aufgrund der Politisierung der Wissenschaft“ aus Trumps USA nach Österreich auswandert. Im Spin-off der Österreichischen Akademie der Wissenschaften will er nun (mit Förderungen der Boehringer-Ingelheim-Stiftung) ein KI-gesteuertes Robotiklabor aufbauen, das medizinische und biotechnologische Experimente unterstützt. „Und wo könnte man das besser tun als in Wien?“, so Malik über seinen neuen Lebensmittelpunkt. „Die Stadt ist nicht nur eine der schönsten und lebenswertesten Städte der Welt, sondern auch ein pulsierendes, internationales Forschungszentrum mit einer florierenden Wissenschafts- und Innovationsgemeinschaft.“
Ins Austro-Exil
Der KI-Experte ist bei weitem nicht der einzige US-amerikanische Spitzenforscher, der seine Zelte in der Heimat wegen massiver Budgetkürzungen und wissenschaftsfeindlicher Grundschwingungen abbricht. 26 führende Köpfe tauschten Harvard, Princeton oder das MIT gegen die MedUni Wien, die TU Graz oder das Institute of Science and Technology Austria (ISTA), darunter Kapazunder wie die Anthropologin Audrey Lin vom American Museum of Natural History, die Materialphysikerin Jigyasa Nigam (zuvor: MIT und Harvard) oder der Chemiker Mihai Popescu (Colorado State University). Ihre mit je 500.000 Euro über 48 Monate dotierten Stipendien finanziert das Programm APART-USA der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). „Mit unserem Stipendienprogramm ist es gelungen, diese exzellenten Persönlichkeiten aus den USA nach Österreich zu holen. Sie bringen neue Ideen, neue Perspektiven und internationale Netzwerke mit – das ist ein großer Gewinn für die österreichische Wissenschaft und ein wichtiger Impuls für die internationale Sichtbarkeit unseres Forschungsstandorts“, freut sich ÖAW-Präsident Heinz Faßmann. Und setzt sarkastisch nach: „Trump sei Dank für diesen Brain Gain.“
Stabil und zentral
Um den Brain Drain aus dem Ausland in Fahrt zu bringen, der einen Brain Gain für Österreich bewirken soll, wird es aber noch mehr Argumente als die Abwesenheit von Donald Trump brauchen. Was aber schätzen internationale Talente, Unternehmen und Investor:innen an der kleinen Alpenrepublik – außer Strudel, Charme und schönen Bergen? Die Austrian Business Agency (ABA), die offizielle Ansiedlungsagentur der Republik, zählt auf ihrer Website unter anderem die folgenden Gründe auf:
die Förderung von Innovation (etwa in Form von Forschungsförderungsprogrammen und 14 Prozent Forschungsprämie);
die Investitionen in den Ausbau von Telekommunikationsinfrastruktur und Hochleistungsnetzen;
das verlässliche Rechtssystem, die politische Stabilität, die soziale Zufriedenheit sowie die ausgezeichnete Versorgung durch medizinische Fachleute und das dichte Netz an öffentlichen und privaten Spitälern; die hohe Lebensqualität („Nicht nur Kulturnation und Reiseziel, sondern auch Wahlheimat internationaler Fachkräfte und Unternehmen.“);
und die zentrale Lage als gesamteuropäischer Verkehrsknotenpunkt an den Kreuzungen aller wichtigen Daten- und Energieleitungen, gepaart mit einer stabilen Energieversorgung und einem überdurchschnittlich grünen Energiemix.
Wettbewerbsfähigkeit stärken
Für viele internationale Unternehmen und Institutionen ist das ein attraktiver Mix. Allein in der Hauptstadt haben 40 große internationale Organisationen wie UNO, IAEO, OPEC, OSZE und UNIDO und 184 internationale Headquarters ihren Sitz, in ganz Österreich sind es 403, erhob 2024 eine Studie der WU.
Doch das gute Image bröckelt. Im Competitiveness Report des IMD ist die Alpenrepublik seit 2020 von Platz 16 auf Platz 26 zurückgefallen. Und vier von zehn heimischen Unternehmen haben laut einer von der Wirtschaftskammer in Auftrag gegebenen Studie bereits Teile ihrer Produktion ins Ausland verlagert.
Was tun? Unternehmensgründungen erleichtern, Arbeitsmarkt flexibilisieren, entbürokratisieren, Budget sanieren und den Fokus auf Digitalisierung und KI legen, empfiehlt der Deloitte Radar 2025. „In Bildung und Technologie investieren“, „Gründer:innen fördern“, „die digitale Transformation vorantreiben“ und „Kapitalmärkte stärken“ raten die vier von profil Extra befragten internationalen Führungskräfte, die in Österreich leben, arbeiten und Zukunft gestalten. Sie kennen sowohl die Wirtschaftswelt diesseits als auch jenseits des rot-weiß-roten Tellerrands. Im Interesse unserer Standort-Attraktivität täten wir gut daran, ihren Blick von außen zur kritischen Selbstreflexion zu nützen.
„Österreich könnte mutiger werden“
Alejandro Plater, CEO A1 Group
Was spricht für den Wirtschaftsstandort Österreich und wo sehen Sie seine größte Schwäche?
Alejandro Plater
Österreich überzeugt mit seiner stabilen politischen und wirtschaftlichen Lage, einer hervorragenden Infrastruktur und einem hohen Bildungsniveau der Bevölkerung. Das Land bietet robuste Bedingungen für international ausgerichtete Unternehmen und ist eine hervorragende Plattform, um unsere Aktivitäten in ganz Europa auszuweiten. Auf der anderen Seite sehe ich die größte Schwäche in dem mangelnden Ehrgeiz, den Status quo in Frage zu stellen, und in der oft fehlenden Neugierde. Neugier treibt das Lernen voran, Lernen fördert Innovation. Innovation treibt das Wachstum voran und Wachstum schafft Beschäftigung. Österreich könnte hier etwas mutiger werden.
Verglichen mit anderen Standorten bietet Österreich …
Alejandro Plater
… ein sehr hohes Maß an kompetenten Mitarbeiter:innen, mit hoher Professionalität und ethischen Standards. Auch die Lebensqualität ist ein Pluspunkt, wenn es darum geht, internationale Fachkräfte anzuwerben. Um diesen Wettbewerbsvorteil zu erhalten, ist kontinuierliches Re-Skilling von entscheidender Bedeutung.
Wie gut können Ideen und Talente hier gedeihen?
Alejandro Plater
Österreich hat viel Potenzial und fördert Innovation auf vielen Ebenen. Innovation bedeutet aber auch das Eingehen von Risiken. Um zu lernen, innovativ zu sein, müssen wir lernen, über Misserfolge zu diskutieren. In Österreich gibt es eine sehr starke Zurückhaltung, offen und positiv übers Scheitern zu sprechen.
Welche „typisch österreichischen“ Eigenschaften schätzen Sie an Partner:innen und Mitarbeitenden – und an welche Eigenheiten können Sie sich nicht gewöhnen?
Alejandro Plater
Ich schätze das ständige Bemühen um Konsens, die hohe Professionalität und das gute Zuhören. Partnerschaften werden langfristig gesehen, was von großem Wert ist. Die negative Konsequenz der Konsenssuche ist jedoch, dass die Suche nach einem Konsens nicht angesprochen wird, um niemanden zu beleidigen. In einem zu konsensorientierten Umfeld ist Innovation zu langsam, wenn sie überhaupt stattfindet.
Was muss Österreich tun, um auch 2035 in der ersten Liga zu spielen?
Alejandro Plater
Ich glaube, dass das Problem in Österreich die fragmentierte Regulierung ist. Bürokratieabbau, mehr Investitionen in Bildung und Technologie und vor allem ein Mindset, das Unternehmertum und stetige Weiterentwicklung begrüßt, sind die Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg.
„Das Land ist stärker in der Substanz als im Hype“
Mazurka Zeng, Managing Director und CEO Bybit EU
Warum wählt eine der größten Kryptobörsen der Welt Österreich als Europastandort?
Mazurka Zeng
Österreich und insbesondere Wien bieten eine überzeugende Mischung aus Innovation und institutioneller Verlässlichkeit. Als Vorreiter bei MiCAR gab uns Österreich Rechtssicherheit, als viele Märkte noch auf Leitlinien warteten.
Bei Bybit läuft alles digital, man könnte also von überall aus arbeiten …
Mazurka Zeng
Aber Krypto und digitale Finanzen basieren auf Vertrauen. Technologie kann man überall entwickeln, aber Glaubwürdigkeit erfordert einen transparenten Rechtsrahmen und eine klare Aufsicht. Genau das bietet uns Österreich. Im Rahmen von MiCAR konnten wir in jedem der 27 EU-Mitgliedstaaten eine Zulassung beantragen, und wir haben uns für Wien entschieden, weil es die beste Kombination aus regulatorischer Klarheit, einem starken Fintech-Ökosystem und Talenten bot. Die Stadt vereint Fachwissen in den Bereichen Zahlungsverkehr und Regtech, aktive Start-up-Communities und Universitäten, die qualifizierte technische Teams hervorbringen. Wien verbindet die DACH-Region mit Mittel- und Osteuropa und ist damit ein idealer Standort für eine Krypto-Plattform mit globaler Reichweite.
Ist Österreich auch Innovationsland?
Mazurka Zeng
Österreich ist stärker in der Substanz als im Hype. Die Forschungsbasis ist solide, die Regeln sind klar und der Dialog mit den Institutionen ist strukturiert. Universitäten liefern qualifizierte Ingenieur:innen und Produktmanager:innen, Meetups und Accelerators helfen dabei, Ideen reifen zu lassen, und es wächst die Bereitschaft, kleine Schritte zu testen, schnell zu lernen und das, was funktioniert, zu skalieren. Die Kultur schätzt Präzision, was die Messlatte für Sicherheit und Compliance höher legt, während die Start-up-Szene die nötige Geschwindigkeit mitbringt, um Produkte auf den Markt zu bringen. Für eine Krypto-Plattform ist diese Balance produktiv. Sie ermöglicht es Teams, selbstbewusst zu entwickeln, internationale Talente anzuziehen und vom Konzept zum Produkt zu gelangen, ohne an Genauigkeit einzubüßen.
Was fehlt?
Mazurka Zeng
Die Prozesse für Unternehmer:innen und internationale Fachkräfte müssen weiter vereinfacht, die Finanzierungskanäle für Ideen in der Frühphase offen gehalten und der Dialog zwischen Innovator:innen und Regulierungsbehörden aufrechterhalten werden. Die Stärke Österreichs liegt in der Balance zwischen Strenge und Kreativität. Wenn diese Balance geschützt wird, bleibt das Land ein führender Standort für die Entwicklung neuer Ideen.
„Die Verwaltung muss Serviceplattform werden“
Bernd Hake, CEO Woom
Gründe für Österreich als Wirtschaftsstandort sind …?
Bernd Hake
Stabilität und Lebensqualität – in volatilen Zeiten ein entscheidender Standortfaktor, um globale Top-Talente anzuziehen. Die duale Ausbildung, die eine praktische technische Tiefe liefert, die rein akademischen Systemen (z. B. USA/UK) fehlt. Die hohen F&E-Investitionen und das dichte F&E-Ökosystem. Und die Rolle als geographische und kulturelle Drehscheibe zwischen dem DACH-Raum und den CEE-Wachstumsmärkten, die Wien zu einem bevorzugten CEE-Headquarter-Sitz macht.
Welche Nachteile bremsen?
Bernd Hake
Österreich fehlt es an aggressivem Venture Capital und der Mentalität, globale „Winner takes all“-Plattformen zu bauen. Die mangelnde Digitalisierung, besonders in der öffentlichen Verwaltung, wirkt als massive Effizienz-Bremse für die gesamte Wirtschaft und verlangsamt Gründungen sowie Innovationen. Die dominierende „Null-Fehler-Kultur“ und die Angst vor dem Scheitern verhindern essenzielle Lerneffekte aus Experimenten, die für Innovation nötig sind. Und die hohen Lohnnebenkosten verteuern den Faktor Arbeit. So tut sich Österreich im internationalen Talentewettbewerb weiterhin schwer, globale Spitzenkräfte aktiv anzuziehen.
Und welche vier Maßnahmen würden heute auf die berufliche Zukunft Ihrer jungen Zielgruppe einzahlen?
Bernd Hake
Die Stärkung des Humankapitals: Österreich muss die Hürden für MINT-Talente radikal senken und massiv in die digitale Grundausbildung aller investieren. Die Förderung eines robusten, risikofreudigen VC-Markts, weil gute Ideen oft an der Finanzierung in der Wachstumsphase scheitern. Die Verbesserung der digitalen Infrastruktur – die Verwaltung muss als Serviceplattform gedacht werden, jede Interaktion muss digital, reibungslos und einfach sein. Bestmarken setzen hier Länder wie Estland, Dänemark und Südkorea. Und der strategische Fokus auf Themen, in denen Österreich bereits stark ist, etwa Green Tech, komplexe Fertigung und Gesundheitstechnologie.
„Die Lebensqualität übertrifft andere Standorte“
Céline Garaudy-Dumontheil, Generaldirektorin der Französisch-Österreichischen Handelskammer
Was sind die Stärken, was sind die Schwächen des Wirtschaftsstandorts Österreich?
Céline Garaudy-Dumontheil
Österreich bietet Wirtschaftstreibenden politische Stabilität, das Land überzeugt zudem durch seine zentrale Lage in Europa, die gute Infrastruktur und die hohe Lebensqualität in einem sehr internationalen Umfeld. Besonders die Innovationskraft in Bereichen wie Maschinenbau und Erneuerbare Energien ist hervorzuheben. Die größten Schwächen liegen jedoch in den Energiepreisen, dem Mangel an Private Equity für Investitionen und auch der Bürokratie, die den Markteintritt für Unternehmen erschwert.
Was macht Österreich gut, was kann das Ausland besser?
Céline Garaudy-Dumontheil
Österreich übertrifft andere Standorte in Lebensqualität und Industriekapazitäten. Im Vergleich zu Ländern wie Frankreich, Deutschland oder den nordischen Staaten fehlt es vielleicht noch an Aktivitäten im Start-up-Sektor, an Private Equity und digitaler Innovation.
Bräuchte es dafür bessere Rahmenbedingungen?
Céline Garaudy-Dumontheil
Österreich unterstützt Innovationen gut, besonders im Hinblick auf Forschung und Entwicklung. Es gibt zahlreiche Förderprogramme (ABA, Vienna Business Agency …). Weniger Bürokratie könnte vielleicht die Umsetzung von Ideen und Innovationen beschleunigen. Innovationsprozesse könnten dann flexibler und agiler gestaltet werden.
Welche „typisch österreichischen“ Eigenschaften fallen Ihnen im Arbeitsalltag positiv auf?
Céline Garaudy-Dumontheil
Ich schätze die Pünktlichkeit der Österreicher:innen sehr, dazu kommen die Zahlungsseriosität und die hohe Qualität der Arbeit im Bereich Industrie und Handwerk. Für mich als Französin ist auch die Sozialpartnerschaft ein wichtiger Pluspunkt für den Standort.
Was muss Österreich noch tun, um zukunftsfit zu werden und als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig zu sein?
Céline Garaudy-Dumontheil
Wie alle anderen Länder in Europa muss auch Österreich seine digitale Transformation vorantreiben. Gleichzeitig gilt es, die Bürokratie abzubauen und die Innovationsförderung für Start-ups und die Finanzierung zum Scale-up weiter zu stärken. Auch sollte das Land verstärkt internationale Talente anziehen und eine nachhaltige Wirtschaftspolitik forcieren.
Text: Alexander Lisetz