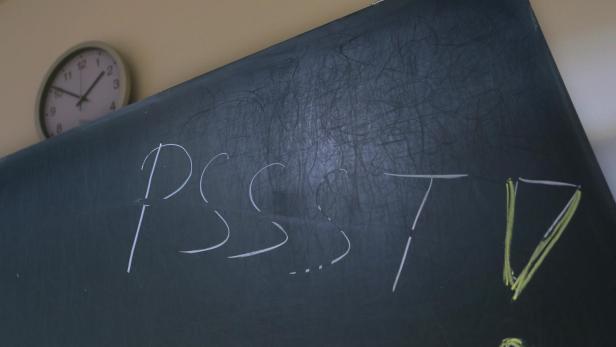Von Fragen bis Klagen: Wie Journalisten an Infos gelangen
Allen, die sich Journalismus als unfassbar spannenden Job vorstellen, gewähre ich gerne einen Einblick in meine Mails. Über die Jahre habe ich auf meine Fragen viele schöne Rückmeldungen bekommen.
Unter den Favoriten: „Diese Anfrage dürfen wir höflich unbeantwortet lassen.“ Die freundliche Bestimmtheit hat mir imponiert. Noch selbstbewusster trat aber der Anwalt einer Partei auf, dem ich eine delikate Finanzierungsfrage gestellt hatte: „Ich gehe davon aus, dass Ihre Anfrage ein Irrläufer war.“
Ich gebe zu, ich musste schmunzeln. Man wird bescheiden und gibt sich schon mit kreativen Auskunftsverweigerungen zufrieden.
Weniger lustig finde ich nach Jahren im Geschäft des Fragenstellens und Oft-keine-Antworten-bekommens die immer gleichen Ausreden. Der absolute Klassiker, die Entsprechung von Behörden für „der Hund hat Hausübung gefressen“: Datenschutz. Erst kürzlich berief sich das Innenministerium auf dieses Recht, nachdem ich gefragt hatte, wie viele Polizeibeamte aufgrund einer Nähe zum Nationalsozialismus vom Dienst suspendiert wurden.
Wessen Datenschutz bei einer statistischen Frage berührt sein könnte, blieb offen.
Vielleicht haben Sie jetzt eine Vorstellung von der Freude, die Journalisten verspüren, wenn sie, oft über Umwege, zu belastbaren Fakten kommen.
Informationsbeschaffung für Fortgeschrittene
Ein anderer Presssprecher sollte sich irren, als er mir auf meine Anfrage hin telefonisch durchgab: „Herr Winter, Sie werden diese Infos von mir nicht bekommen.“
Es ging um den rechtsextremen Verbreiter von Verschwörungsmythen, Stefan Magnet, der ein reichweitenstarkes Online-Medium („AUF1“) betreibt und nebenher eine Werbeagentur hat. Ich hatte die These, dass diese einschlägige Agentur von der oberösterreichischen Landesregierung, vom blauen Teil natürlich, Aufträge bekommt.
Das Land hätte den Braten gerochen, hätte ich direkt nach dieser Agentur gefragt. Also wandte ich eine kleine List an: Ich stellte mich dumm und fragte offiziell nach sämtlichen Werbeagenturen, die vom Land in den vergangenen Jahren beauftragt wurden. Wie ich es vermutet hatte, fand sich die Agentur Magnets auf der Liste. Das Land weigerte sich aber über Monate, mir zu sagen, wie viel Geld geflossen ist und welcher Landesrat den rechtsextremen Werber konkret beauftragt hatte.
Phase zwei meines Plans sah vor, dass ich alle Mitglieder der Proporz-Landesregierung einzeln fragte, ob sie es waren, die Magnet engagiert hatten. Alle antworteten mit einem „Nein“, bis auf zwei freiheitliche Landesräte.
Von der ersten Anfrage bis zur Veröffentlichung des Berichts vergingen gut eineinhalb Jahre.
Bitte warten
Noch etwas länger – gezählte zwei Jahre – dauerte es, die Antworten für die aktuelle profil-Titelgeschichte zu bekommen.
Es ging um eine simple Frage: Wie hoch sind die Mieten, die politische Parteien – allen voran die SPÖ – für Sektionslokale, Lagerhallen und Bezirksparteizentralen zahlen, die im Besitz der Stadt stehen?
Wir recherchierten freilich nicht einfach ins Blaue, sondern hatten einen begründeten Verdacht. 2023 hatte der Wiener Stadtrechnungshof 413 Mietverhältnisse zwischen Stadt und politischen Parteien unter die Lupe genommen. Die Prüfer fanden heraus, dass bei 14 Objekten „keine Indexierung durchgeführt“ wurde. Das heißt: Es sind keine regelmäßigen Mieterhöhungen – etwa zur Abdeckung der Inflation – erfolgt. Und das über Jahrzehnte hinweg.
Der Bericht legte allerdings nicht offen, um welche Objekte es ging. Wir wollten diese Informationslücke mit einer Anfrage nach dem sogenannten Auskunftspflichtgesetz schließen (das ab September vom Informationsfreiheitsgesetz abgelöst wird).
Dass es einen zweijährigen Rechtsstreit brauchen würde, um an diese Daten zu gelangen, hatten wir nicht am Zettel – wir waren aber bereit, ihn zu führen. Jetzt wissen wir, dass die Parteien ab 67 Cent netto pro Quadratmeter für ihre Parteilokale bezahlten.
Die Recherche und die Stadtrechnungshofprüfung dürften ihren Zweck erfüllt haben: Wiener Wohnen hat die Altverträge auf das gesetzliche Maximalniveau angehoben.
Ein Beweis dafür, dass Transparenz zwar lästig wirken mag, für Verbesserungen in Politik und Wirtschaft aber essenziell sind.