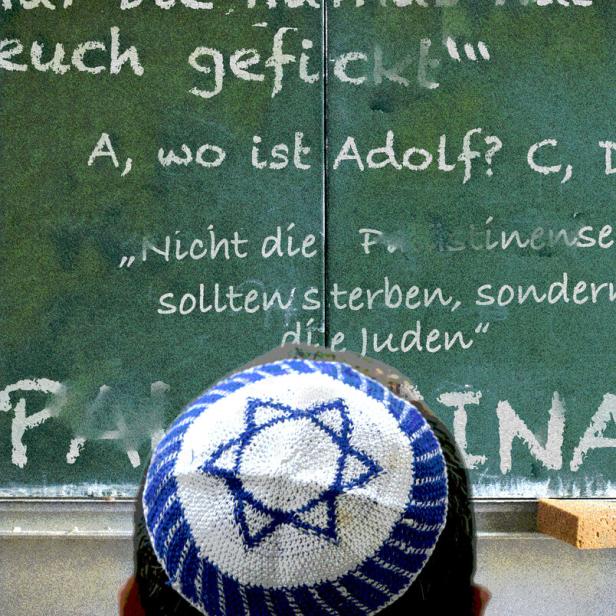Regina Krimmel-Mairinger
Regina Krimmel-Mairinger, Mittelschul-Direktorin
© Wolfgang Paterno
Regina Krimmel-Mairinger
Regina Krimmel-Mairinger, Mittelschul-Direktorin
So geht Schule
Schriftgröße
Die Konstanziagasse liegt im östlichen Wiener Stadtteil Stadlau, in einer Gegend, wo Großstadt-Ausfransung und Dörfliches ineinanderfließen, wo Baumärkte an Ausfallstraßen liegen und alte Ortskerne an Immobilien-Entwicklungsbrachen grenzen. Auf Hausnummer 50 steht ein älteres, dreistöckiges Schulhaus, links am Eingangsportal eine verblasste Plakette („Erbaut von der Gemeinde Wien unter dem Bürgermeister Dr. Josef Neumayer 1911“), rechts ein paar Plakate neueren Datums: „Pilotschule Wirtschaftsbildung“, „Mint Gütesiegel“, „Cambridge English Qualifications“ und „Zertifizierte Expert.Schule“. Darüber klebt in bunten Papierbuchstaben die Aufforderung: „Come Together“, im Gang dahinter rechts eine Reihe Garderobenspinde, links Schulwart, Direktion und Lehrerzimmer. Sie nennen ihre Schule hier kurz „KO50“, nicht „K.O.“ gesprochen bitte, das wäre auch am Thema vorbei.
Nach gängigen Definitionen von Politik und Boulevard ist die KO50 eine „Brennpunktschule“. 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben Migrationshintergrund, die allermeisten sind muslimischen Glaubens, viele von ihnen haben Fluchterfahrung und traumatische Belastungsstörungen, aufgrund derer manches Kind dem Unterricht nicht immer folgen kann, eventuell auch Leistung verweigert oder sogar suizidal ist; eine Schule, in der all jene landen, die sonst nirgends hinkönnen; die niemanden haben, der willens oder fähig ist, sich dafür einzusetzen, dass sie woanders hinkommen, in eine „bessere“ Schule. Die Kinder der autochthonen Österreicherinnen und Österreicher sind hier eine Minderheit und manchmal Außenseiter, die ihrerseits, genauso wie die Kinder mit Migrationshintergrund, „einen schweren sozialen Rucksack tragen“, sagt Regina Krimmel-Mairinger.
Sie ist 57 Jahre alt, dreifache Mutter, seit 1997 Lehrerin und bereits sechs Jahre Direktorin dieser Schule. Sie hätte ihre eigenen Kinder auch hierher geschickt – und sie sagt das, ohne nur einen Moment lang zu zögern. Selbst wenn sie um den schlechten Ruf der Wiener Mittelschulen weiß, mehr als das wiegt ihre persönliche Erfahrung. Für sie ist ihre Schule keine Endstation, sondern ein Ort, an dem jedes Kind befähigt werden soll, seine Zukunft nach seinem Maß, seinen Talenten, seinen Freuden und seiner Façon zu gestalten. „Nicht jedes Kind ist für eine Matura oder ein Studium geeignet – und daran ist nichts schlecht, das bedeutet kein Versagen“, sagt Krimmel-Mairinger. „Aber es gibt für jedes Kind einen Platz im Leben, und unsere Kinder finden tatsächlich ihren Platz im Leben.“ Viele Absolventen kommen Jahre später wieder zurück und erzählen uns von ihrem Leben und was ihnen gelungen ist. Das sei die größte Bestätigung ihrer Arbeit! Die Konstanziagasse 50 ist die Schule, wo man nicht für die Schule lernt, sondern fürs Leben. Krimmel-Mairinger sagt, sie hat ein Problem mit dem Begriff „Brennpunktschule“. Sie sagt, ihre Schule ist etwas anderes – eine Zukunftsschule.
Mit Händen und Füßen
Dienstag, zweiter Schultag, 7.30 Uhr. Regina Krimmel-Mairinger macht Kaffee. Die Tür zwischen Direktion und Lehrerzimmer steht offen, drüben herrscht eine aufgekratzte Stimmung, offene Fenster, helles Licht, lautes Geplauder. An der Wand der Bundespräsident, daneben Urkunden und Auszeichnungen. Eine Kollegin schaut herein: „Darf ich dich kurz unter vier Augen sprechen?“ Sie braucht eine schnelle Entscheidung, der neu zugeteilte Schüler in der 4B spricht leider kein Wort Deutsch. Was machen wir mit ihm? Die Mutter ist auch mitgekommen und hat Blumen mitgebracht, es entsteht ein Gespräch mit Händen und Füßen sowie ein vorläufiger Plan. Zunächst einmal kommt der Bub in einen Deutschförderkurs, „und dann schauen wir mal, wo wir ihn einstufen“, bestimmt die Direktorin. Kurzes Durchschnaufen. „Ja, das sind dann so die Überraschungen, die man zum Schulbeginn erlebt.“
Es gibt aber auch angenehme. Erst gestern habe ihr eine Mutter erzählt, dass die 100 Euro, die sie als Selbstbehalt für das Schul-Tablet einbezahlt hat, endlich zurücküberwiesen wurden. Aus sozialen Gründen wurde sie eigentlich von der Gebühr befreit. Das war vor eineinhalb Jahren. Es wurde viel telefoniert, Krimmel-Mairinger hat sich eingesetzt. „Gestern ist sie extra in die Schule gekommen, um mir Bescheid zu sagen. Das hat mich schon sehr berührt.“

Schüler der Konstanziagasse 50 in Wien-Donaustadt
Schüler der Konstanziagasse 50 in Wien-Donaustadt
© Wolfgang Paterno
Schüler der Konstanziagasse 50 in Wien-Donaustadt
Schüler der Konstanziagasse 50 in Wien-Donaustadt
Regina Krimmel-Mairinger hat ein lautes Lachen und eine stille Autorität. Ihre Art, Schule und Pädagogik zu denken und zu leben, hat etwas Widerspenstiges, denn sie beugt sich nicht dem gängigen Leistungsdiktat, das Lebenserfolg vielfach über Bildungsabschlüsse definiert. Für sie ist Erfolg im Leben, wenn man das findet, wo man sich gut und gerne entfalten möchte.
In dieser grauen Schule am Wiener Stadtrand, die auf den ersten Blick gewöhnlicher nicht sein könnte, herrscht der Anspruch, dass dies ein Ort des radikalen Individualismus sein soll. Für Kinder, denen das Leben Zwänge auferlegt hat, aus denen es auf den ersten Blick kein Entrinnen gibt.
In der KO50 arbeiten 380 Schüler und 45 Lehrer – Frau Direktor gendert übrigens nicht, sie hat gerade andere Sorgen: „Wir haben heuer einen Start mit Hürden.“ Zwei Tage vor Schulbeginn wurde im Schulhaus eingebrochen, Krimmel-Mairinger formuliert es so: „Es gibt Herausforderungen.“ Sie sagt es erstaunlicherweise mit beinahe schon strahlender Vorfreude, Hindernisse scheinen sie zu motivieren. Obwohl: Am ersten Tag der Sommerferien hat ihr eine langjährige Lehrerin verkündet, dass sie ein sehr gutes Angebot in einer BHS erhalten habe. Krimmel-Mairinger verstand, dass die Kollegin das Angebot nicht ablehnen konnte, musste aber nun über den Sommer eine Nachbesetzung auftreiben, es gibt einfachere Übungen. „Die Lehrerfluktuation ist gerade an den Mittelschulen leider sehr hoch.“
Auch deshalb lautet Krimmel-Mairingers Grundprinzip ganz bewusst nicht „Direktor sagt, Lehrer macht“. Stattdessen werden unter den Kollegen Verantwortlichkeiten verteilt, Zukunfts- und Bildungsfragen in Arbeitsgruppen beantwortet. Auch Lehrer wachsen mit ihren Aufgaben. „Das Team muss für seine Aufgabe brennen“, erklärt die Direktorin: „Ich kann den Funken geben, aber ich kann Engagement nicht verordnen.“
Kleines Paradies
Die 3C steht am Gang und stellt ihre Spindschlösser ein, in der 2B erklären Kinder und Lehrerinnen unisono, dass ihre ganz eindeutig die schönste Klasse in der ganzen Schule sei. Mariam, 12, erzählt von ihren Ferien. Sie war in Tirol und ist von einem riesigen Sprungturm in einen eiskalten, fast schwarzen See gesprungen. Ein Mädchen aus der 3A zupft die Direktorin am Ärmel: „Ich habe die Nachprüfung bestanden!“ In der 4C unterhalten sich der Klassenlehrer Jonathan Byrne und seine Stellvertreterin Magdalena Osawaru mit ihren Schülerinnen. Er spricht nur Englisch, sie glasklares Oberösterreichisch. Die KO50 ist eine „Junior High School“ mit teilweise englischsprachigem Unterricht. Frage an die Klasse: Für wen waren die Ferien zu kurz? Fast alle Hände gehen nach oben.

Unterricht in der Mittelschule Konstanziagasse 50 in Wien Donaustadt
Unterricht in der Mittelschule Konstanziagasse 50 in Wien Donaustadt
© Wolfgang Paterno
Unterricht in der Mittelschule Konstanziagasse 50 in Wien Donaustadt
Unterricht in der Mittelschule Konstanziagasse 50 in Wien Donaustadt
Die Klassen sind heute, am zweiten Schultag, fast durchwegs doppelt besetzt, die Direktorin lässt ihr Personal an der langen Leine. Jeder soll in dieser Woche seine Lehrverpflichtung ausfüllen, aber nicht zwangsläufig im festgezurrten Stundenplan, das gibt Freiheiten und Entspannung, Zeit für Gespräche. „Wir versuchen, den Druck herauszunehmen“, sagt Krimmel-Mairinger. Robert Wazek macht mit der 4A trotzdem schon einmal Stoff. Der Mathe-Lehrer wiederholt Subtraktion und Potenzierung von Brüchen, die Ansprache ist laut und deutlich, aber mit ausgeprägtem Respekt und einigem Schmäh vorgetragen. Zwischen zwei Brüchen flüstert Wazek: „Schauen Sie, wir haben hier ein Sammelsurium aus allen Nationen und ein super Klassengefüge. Ich sage immer, das ist unser kleines Paradies. Da hinten sitzt ein Bub aus Israel neben einem Muslim, kein Problem!“
Obwohl gerade noch Sommerferien waren, hängt in der Luft schon der Geruch von Jausenbroten und Patschen; es ist dieser typische Schulmief, der jeden, der eine österreichische Schule besucht hat, sogleich in die eigene Schulzeit katapultiert. Zumindest das ändert sich nicht. Aber alle anderen Veränderungen einer Gesellschaft manifestieren sich an Orten wie diesen sofort.
Schulen sind wie Seismografen, sie zeigen, wo und wie sie sich eine Stadt, ein Land verändert.
Die Pädagogin Krimmel-Mairinger ist seit 28 Jahren im Dienst. Jede Einwanderungswelle, jede Fluchtbewegung ist seither wie eine neue Staffel einer Serie an ihr vorübergezogen: die Kinder, die als Flüchtlinge nach dem Zerfall Jugoslawiens in Wien aufschlugen, die Tschetschenen, die Syrer, die Ukrainer. Krimmel-Mairinger sagt, sie wollte Lehrerin werden dort, wo sie wirklich gebraucht wird, dort, wo sie etwas bewegen kann, wo sie selbst einen Unterschied machen kann.
Sie selbst beginnt nach der Matura sogleich mit ihrer pädagogischen Ausbildung, entscheidet sich aber in ihren Zwanzigern gegen das Unterrichten. Sie traut es sich anfangs nicht zu und ist zehn Jahre lang Erzieherin („Heute würde man Nachmittagsbetreuerin sagen“) in einer katholischen Privatschule. Danach springt sie ins kalte Wasser und lehrt insgesamt 22 Jahre in der MSi Geblergasse in Wien-Hernals.
Vieles habe sich seither geändert, nicht nur die Tafeln, die heute digital sind, sondern auch der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern. Die heutigen Mittelschulen, einst Hauptschulen genannt, waren damals schon hauptsächlich mit Kindern von Migrantinnen und Migranten besetzt. Der Umgang sei damals härter gewesen, sagt Krimmel-Mairinger. Man sei mehr drübergefahren, sie erinnert sich, Kinder wurden oft angehalten, Deutsch untereinander zu sprechen und nicht ihre Muttersprachen. Heute sei das Bildungswesen zum Glück weiter, respektvoller und mit mehr Gespür für die Kinder.
Es ist eine gegenläufige Entwicklung zur allgemeinen politischen Atmosphäre: Während Migrantinnen und Migranten immer mehr stigmatisiert werden, entsteht gerade in den Schulen, gerade an jenen Orten, die durch die Zuwanderung besonders gefordert sind, eine Art neuer Humanismus, gerade in der Lehrerschaft. Und das ist wohl auch ein unvorhergesehener Nebeneffekt des viel beklagten Lehrermangels: Als Krimmel-Mairinger zu unterrichten begann, konnte sie nicht wählen, wo sie hingeht. Jene, die heute in der Konstanziagasse 50 unterrichten, könnten jederzeit gehen und woanders arbeiten, denn Lehrerinnen und Lehrer werden händeringend gesucht. Doch sie ziehen es vor, zu bleiben – weil sie hier etwas verändern können, und weil sie es auch wollen.

Konstanziagasse 50, Wien-Donaustadt
Konstanziagasse 50, Wien-Donaustadt
© Wolfgang Paterno
Konstanziagasse 50, Wien-Donaustadt
Konstanziagasse 50, Wien-Donaustadt
Die 2A wird von Nikolaus Bublik und Natascha Brandl geführt, die Kinder heißen Yasin, Naveed, Latifah, Anas und Farhan. Die 2A ist die Integrationsklasse der KO50, von 23 Kindern haben hier sechs einen sonderpädagogischen Förderbedarf und einen eigenen Lehrplan. Bublik ist – mit einer Unterbrechung – seit 23 Jahren an der KO50, er kennt die Geschichte der Schule sehr genau. Anfang der 2000er-Jahre stand die Schule vor dem Aus, „sie hatte einen fürchterlichen Ruf“. Aber sie hat die Kurve gekriegt, „vor allem der Junior-High-School-Ansatz mit Englisch-Schwerpunkt hat uns wirklich geholfen“. Viele Kinder in der Integrationsklasse sind schon älter, als es ihrer Schulstufe entspricht, sie kommen schon mit Jahrgangsverzögerung aus der Volksschule hierher. „Der Sprachstand ist immer ein Problem. Viele Schulbücher können wir auch nur beschränkt verwenden. Aber wir haben gelernt, damit umzugehen.“ Aktuell hat in der 2A genau ein Kind keinen Migrationshintergrund, aber die Vielfalt, die hier herrscht, habe auch Vorteile: „Die Kinder müssen, weil sie so viele verschiedene Muttersprachen haben, halt auf Deutsch oder Englisch miteinander kommunizieren.“ Auch seine Direktorin sieht diesen Punkt: „Ich stecke meine außerordentlichen Schüler nicht gern in eigene Deutschförder-Klassen. Die Kinder lernen am schnellsten, wenn sie im Sprachbad schwimmen, und außerdem sollen sie eine Heimatklasse haben und keine abgekapselte Struktur sein. Viele unserer Schülerinnen haben diese Erfahrung gemacht, wie es ist, ohne Deutschkenntnisse hierherzukommen. Umso besser können sie neue Schüler in dieser Situation begleiten. Sie wissen, wie sich das anfühlt.“

Konstanziagasse 50, Wien-Donaustadt
Konstanziagasse 50, Wien-Donaustadt
© Wolfgang Paterno
Konstanziagasse 50, Wien-Donaustadt
Konstanziagasse 50, Wien-Donaustadt
Es klopft, eine Kollegin steht am Gang. „Nikolaus, bitte kannst du kurz kommen?“ Es gibt da ein Problem in der 1B. Bublik schnappt sich einen Packen Arbeitsblätter und wechselt die Klasse. Schule ist Improvisieren.
Viele ihrer Schülerinnen und Schüler könnten in Englisch mit Gymnasiasten locker mithalten, sagt Krimmel-Mairinger. Manche würden es auch ins Gymnasium schaffen, aber nicht alle, und das sei auch nicht das Ziel. „Unsere Gesellschaft braucht auch Arbeiter, Handwerker, Menschen im Sozialbereich, Pflegekräfte – es geht um die Frage, was mich erfüllt und wo ich etwas beitragen kann.“ Die Elternarbeit sei immer eine besondere Herausforderung, das sei in ihrer gesamten schulischen Karriere nie anders gewesen, sagt Krimmel-Mairinger. Sie sieht viele Ursachen dafür, nicht nur mangelnde Deutschkenntnisse, dafür gibt es heute im Gegensatz zu früher Videodolmetsch und auch Übersetzungs-Apps, sondern auch, dass viele Eltern prekäre Jobs haben und beispielsweise Nachtschichten schieben. Viele ihrer Schülerinnen und Schüler würden die tagtäglichen Lebensumstände der Familien, aus denen sie kommen, zu einer Selbstständigkeit zwingen, für die sie aufgrund ihres Alters einfach nicht reif genug wären. Etwa, dass sie morgens allein aufstehen, sich allein fertigmachen, frühstücken, alles beisammenhaben.
Die Eltern einzubinden, sei auch deswegen nicht leicht, weil viele von ihnen aus Ländern stammen, in denen die Schulen als Orte des unterdrückerischen Regimes gelten; als Behörden, mit denen man möglichst wenig zu tun haben möchte. Dass die Schule zwar auch eine Behörde ist, aber diese für die beste Zukunft der Schülerinnen und Schüler arbeitet, das müsste man immer wieder aufs Neue verständlich machen. Und: Sie will unbedingt, dass die Kinder es trotz ihrer familiären Umstände und trotz ihrer schwierigen Situationen schaffen. Nicht selten entsteht dadurch ein tiefes Vertrauen. Die Kinder erzählen den Lehrern, wie sie leben und was sie brauchen. Es sei eine engere Beziehung als in Gymnasien, sagt Krimmel-Mairinger, wenn auch der Stoff derselbe ist. „Aber unsere Herangehensweise ist anders.“
Zurück im Büro der Direktorin, Frau Krimmel-Mairinger erzählt über ihren Alltag. Die Direktorin ist meistens von 7 bis 18 Uhr im Haus, manchmal länger, „aber daran bin ich selbst schuld. Gerne begrüße ich die Schülerinnen und Schüler um drei viertel acht hier vor meiner Tür. Dann sehe ich, wie sie hier ankommen.“ Dass die Schule kein Fitnessstudio ist und man sich hier auch ordentlich begrüßt, lässt sich bei der Gelegenheit ganz gut vermitteln. Tatsächlich erlebt man zumindest an diesem zweiten Schultag in der KO50 keinerlei blöden Sprüche, auch keine provokante Höflichkeit, sondern ziemlich selbstverständliches „Grüß Gott“ und „Dankeschön“, in den Klassen schon auch ein altersgemäß tiefergelegtes Abhängen, aber insgesamt doch eine sehr präsente Anwesenheit.
Es klopft, schon wieder, nur ganz kurz, ein Formular wird hereingereicht, dazu leichtes Kopfschütteln: „Nachprüfung, er hat es leider nicht geschafft. Wir überlegen uns bei jedem Kind sehr genau, ob es sinnvoll ist, es in die nächste Schulstufe mitzunehmen oder nicht“, sagt Krimmel-Mairinger: „Denn es ändert sich ja oft auch nichts, wenn jemand die Klasse wiederholt. Die Situation zu Hause bleibt dieselbe. Ein AHS-Schüler bekommt in so einer Situation meist mehr Unterstützung und muss diese Situation nicht allein durchstehen. Bei uns sind die Kinder im Sommer oft im Heimatland, und die Eltern haben kein Geld für Nachhilfe und auch selbst nicht ausreichend Möglichkeiten, zu unterstützen. Das ist unsere Realität.“
Krimmel-Mairinger ist eine echte Optimistin, und das zeigt sich auch daran, dass sie Sätze sagt wie: „Österreich hat ein tolles Schulsystem.“ Denn es würde trotz allem immer wieder Abzweigungen bieten, immer wieder Chancen, etwas zu verändern, um einen neuen Weg einzuschlagen. Die Kinder dazu zu befähigen, sich zuzutrauen, jene Abzweigungen zu nehmen, die für sie gut sind – das sieht sie als ihre Aufgabe. Sie findet, es braucht eine gemeinsame Schule, damit die Kinder nicht das Gefühl haben, auf dem Restplatz zu landen. Dass dadurch die soziale Durchmischung nicht automatisch stattfinden würde, das weiß sie – aber die Punzierung wäre weg und ein Wettbewerb der Schulen möglich, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten locken könnten.
Ganz oben unter dem Dach, im 3. Stock der KO50, gibt es in einem ehemaligen EDV-Zimmer einen Raum, der ein bisschen nach Abstellkammer aussieht, aber bald ein Lehrererholungszimmer werden soll. Noch fehlt freilich die nötige Infrastruktur, zum Beispiel eine Couch oder überhaupt eine Sitzgelegenheit. Gegenüber hat die Schul-Sozialarbeiterin Michaela Saguti ihren (vollständig möblierten) Raum. Schülerinnen und Schüler können sich selbstständig einen Termin mit ihr ausmachen, manchmal bitten auch die Lehrer sie, in einer akuten Situation einzuschreiten. Oft geht es zunächst um Konflikte in der Klasse, „aber fast immer steht im Hintergrund ein Problem zu Hause“, sagt Saguti, die hier eng mit der Psychagogin der Schule, Regina Rathammer-Steiner, zusammenarbeitet. Beide sind an je drei Tagen an der KO50 und führen kurzfristige Interventionen durch oder auch monatelange Begleitungen. „Der Bedarf ist groß“, sagt die Sozialarbeiterin Saguti, „ich könnte jeden Tag hier sein, und trotzdem wäre noch immer genug zu tun.“
Die Umstände sind nicht rosig. Aber man kann daran arbeiten und wird, wenn man es richtig macht, auch Erfolge sehen. Diese Erfahrung machen hier nicht nur die Jugendlichen.

Nina Brnada
ist Redakteurin im Österreich-Ressort. Davor Falter Wochenzeitung.

Sebastian Hofer
schreibt seit 2002 im profil über Gesellschaft und Popkultur. Ist seit 2020 Textchef und seit 2025 stellvertretender Chefredakteur dieses Magazins.