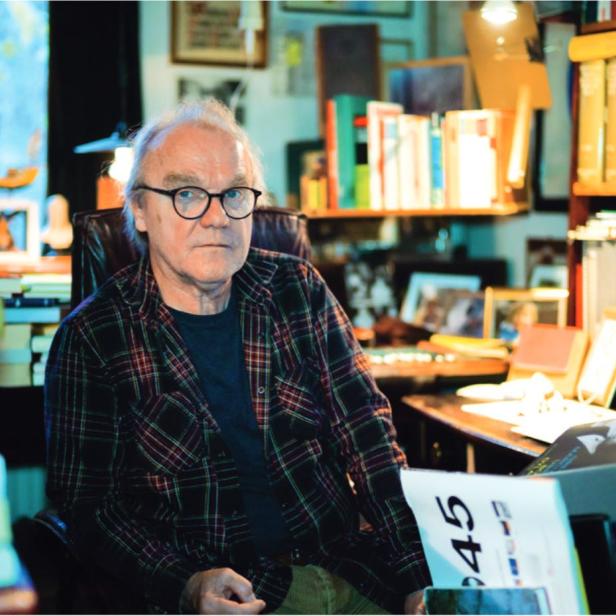Der Neoliberalismus ist seit der Corona-Krise tot: Was kommt danach?
Die Staatsschulden steigen ins Unermessliche, Wirtschaftshilfen in Milliardenhöhe werden ausgeschüttet, Verstaatlichungen geplant, neue Handelsschranken errichtet. 2020 erlebte ein beispielloses Comeback der Staatswirtschaft. Ist der Neoliberalismus am Ende? Und haben es die Börsen einfach noch nicht gemerkt?
Es war einmal eine Ideologie, sehr mächtig im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert. Die Menschen sangen das Hohelied auf alles Private. Der Staat müsse aus der Wirtschaft verdrängt werden, hieß es. Je weniger Staat, je entfesselter die Märkte, desto freier und wohlhabender die Menschen. Doch nach einigen Jahrzehnten erkannten die Leute, dass sie sich täuschen hatten lassen. In Wahrheit hatten Großkonzerne und Superreiche die Ideologie genutzt, um Steuern zu sparen und sich auf Kosten der Mittelschichten zu bereichern. Nachdem die Menschen den Schwindel entdeckt hatten, vollzogen sie eine Kehrtwende. Sie wählten Politiker, die eine Renaissance von Staat, Öffentlichkeit und Gemeinschaft propagierten: Yanis Varoufakis in Griechenland, Pablo Iglesias in Spanien oder Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez in den USA. Seither sorgen diese Politiker dafür, dass die Mittelschichten nicht länger zu den Verlierern gehören.
So oder ähnlich sieht das Weltbild (und die Wunschvorstellung) vieler aus, die sich wirtschaftspolitisch als links-progressiv begreifen. Ihr Feindbild heißt "Neoliberalismus". Dieser war, zumindest in den Augen seiner Kritiker, die alles beherrschende wirtschaftspolitische Ideologie der vergangenen Jahrzehnte. Seine Kernelemente: die Privatisierung und Liberalisierung öffentlicher Bereiche, der Rückbau sozialstaatlicher Leistungen, umfassende internationale Vernetzung und Globalisierung.
Diese Erzählung muss in einem entscheidenden Aspekt revidiert werden. Ja, der Neoliberalismus war mächtig. Aber in den letzten Jahren ist er leise verschieden. Man merkt es nur nicht.
Allerspätestens seit der Corona-Krise kehrt in vielen Ländern der Staat zurück - in einer Dimension, die noch vor Kurzem kaum jemand für möglich gehalten hätte. Immens steigende Staatsschulden? Überhaupt kein Problem. Privatisierungen? Stehen nicht mehr auf dem Programm, stattdessen werden Reverstaatlichungen eingeleitet. Freihandel? Gilt inzwischen eher als Gefahr denn als anzustrebendes Ziel. Staatliche Eingriffe in die Wirtschaft? Sind notwendig, her damit!
Mehrere Faktoren haben zu dieser Entwicklung beigetragen. Dazu gehört die Sorge über den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas, der die jahrhundertelange Hegemonie der westlichen Welt zu brechen droht. Da wäre außerdem die besagte Corona-Krise, die zu Maßnahmen zwingt, die so ganz und gar nicht zum Glauben an den freien Markt passen. Und dann ist da noch die Erkenntnis mancher Politiker, dass das Diktum von "mehr Privat, weniger Staat" bei den Wählern heute nicht mehr so zieht wie noch vor wenigen Jahren.
Das Ende des Neoliberalismus vollzieht sich völlig anders, als viele Linke es sich ausgemalt haben. Es ist kein progressives, emanzipatorisches Projekt mündiger Bürger; keine Revolution an der Wahlurne. Stattdessen wird der Neoliberalismus still durch die Hintertür entsorgt, ohne dass sich am allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Diskurs viel ändern würde. Manche Politiker bringen es sogar fertig, weiterhin von der Entfesselung der Wirtschaft zu schwafeln, während sie faktisch eine ganz andere Politik verfolgen. In Wahrheit vollziehen heute praktisch alle westlichen Regierungen eine Abwendung vom freien Handel und schlanken Staat.
Meistens passiert das ohne großes Gerede; und ganz unabhängig davon, ob ihre sonstige Ausrichtung linksliberal, rechtsdemagogisch, konservativ oder sonst wie ausfällt. Die Totengräber des Neoliberalismus heißen nicht Yanis Varoufakis oder Alexandria Ocasio-Cortez. Sondern Donald Trump, Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron und Sebastian Kurz.
Wer der Verblichene überhaupt war, bleibt dabei höchst umstritten. Der deutsch-amerikanische Ökonom Hans-Helmut Kotz definiert den Neoliberalismus als einen "Laissez-faire-Liberalismus, der die Befreiung der Wirtschaft von regulatorischen Zwängen betont". Fest steht, dass der Begriff Neoliberalismus ausschließlich von seinen Kritikern verwendet wird. Und dies meist auf ziemlich diffuse Weise; als Breitbandargument gegen alles, was nach kaltherzigem Gewinnstreben riecht. Dennoch ist der Neoliberalismus keine bloße Erfindung seiner Gegner. Renommierte Wissenschafter wie der serbischamerikanische Ökonom Branko Milanović wiesen nach, dass zahlreiche politische Maßnahmen der vergangenen Jahrzehnte - von neuen Steuergesetzen bis zur Deregulierung des Finanzmarkts -auf Kosten der breiten Mittelschichten im Westen gingen. Diese büßten Einkommen und Aufstiegschancen ein. Umgekehrt schwoll das Vermögen der Reichen in aller Welt an. Aber auch jenes der Mittelschichten in Schwellenländern wie China und Indien wuchs beträchtlich.
Um den Untergang des Neoliberalismus in Aktion zu sehen, muss man nicht nach Asien blicken. Es reicht die Beobachtung des Politikgeschehens in Österreich. Hierzulande hat ausgerechnet die ÖVP, die dominante Regierungspartei der vergangenen Jahre, in wirtschaftspolitischer Hinsicht eine stille, aber eindrückliche Kehrtwende hingelegt. Stets haben die Konservativen propagiert, den Markt stärken und den Handel vertiefen zu wollen; außerdem lehnten sie hohe Staatsschulden mit geradezu rabiatem Eifer ab. Heute ist von all dem keine Rede mehr. Und das nicht erst seit Corona.
Der Sinneswandel betrifft auch internationale Handelsabkommen. Noch vor einigen Jahren hat man Pakte wie CETA und TTIP kompromisslos befürwortet. Anfang 2020 hingegen verweigerte die heimische Regierung dem EU-Lateinamerika-Abkommen Mercosur als "Gefahr für europäische Bauern" die Zustimmung.
Oder Investitionen aus dem Ausland. Früher galten sie uneingeschränkt als Segen für den Wirtschaftsstandort Österreich. Seit dem vergangenen Sommer sieht ein neues Investitionskontrollgesetz vor, dass bestimmte Direktinvestitionen und Betriebsübernahmen durch ausländische Akteure, etwa aus China, vom Wirtschaftsministerium kontrolliert und bewilligt werden müssen.
Oder Privatisierungen. Bis vor wenigen Jahren sollten Staatsbetriebe möglichst restlos abverkauft werden. Der Privatsektor könne Unternehmen in jedem Fall besser führen als der Staat, so lautete das Dogma. Im Jahr 2018 schlug die damals schwarzblaue Regierung den umgekehrten Weg ein: Sie ging mit der Idee einer Art Österreich-Staatsfonds schwanger. In dessen Rahmen sollten Beteiligungen an strategisch wichtigen Unternehmen aufgebaut und die Gewinne daraus der Republik zugeleitet werden.
Und dann kam die Corona-Krise. Um deren Auswirkungen auf die Wirtschaft zu bekämpfen, fließt staatliches Geld ohne Ende: Umsatzersatz, Fixkostenzuschüsse, Kreditgarantien. Österreichs Staatsschuldenquote -das Verhältnis der Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung - ist im Jahr 2020 so stark angestiegen wie nie zuvor in der Zweiten Republik. Von 70,5 Prozent im Jahr 2019 wird die Quote bis kommendes Jahr auf (prognostizierte) 87,9 Prozent klettern.
Wohlgemerkt: Es ist keineswegs unklug, zur Bekämpfung einer Krise viel Geld in die Hand zu nehmen. Die meisten anderen Länder machen es genauso wie Österreich. Dieses Vorgehen verhindert Massenarbeitslosigkeit und Unternehmenspleiten, deren Bekämpfung dem Staat später noch teurer käme. Dennoch ist es fast ironisch, dass der größte Schuldenanstieg in mehr als einem halben Jahrhundert ausgerechnet aufs Konto einer ÖVP-dominierten Regierung geht. Seit Jahr und Tag warnt die Partei davor, dass Staatsschulden "Zukunftsfähigkeit rauben". Wirklich "zukunftsfähige Politik" trachte danach, "die Staatsschulden endlich abzubauen", verkündete der damalige ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer im Jahr 2018. Und, falls sich irgendjemand noch daran erinnert: Im Dezember 2019 präsentierte Sebastian Kurz die Abkehr von neuen Schulden als Schwerpunkt der türkis-grünen Bundesregierung.
Nun zerfallen derzeit allerdings viele Positionen, die noch vor wenigen Jahren in Beton gegossen schienen, binnen kurzer Zeit zu Staub. Das Phänomen lässt sich nicht nur in Österreich beobachten. Angela Merkel und Emmanuel Macron wollen eine neue europäische "Industriepolitik" aufsetzen. In ihrem Rahmen sollen Bereiche wie Chip-oder Batterie-Produktionen in der EU staatlich hochgepäppelt werden. Im Hintergrund lauert die Angst, China könnte in Zukunftsbranchen wie der E-Mobilität wirtschaftlich davonziehen (seinerseits mit massivem staatlichen Anschub). Vergessen sind die alten Argumente, wonach der Staat nicht wirtschaften könne. Vergessen die Kritik an Interventionismus und Protektionismus, die den freien Wettbewerb hemmen und damit zum Scheitern verurteilt seien.
Noch klarer als in der EU zeigt sich das Ende des Neoliberalismus in den Vereinigten Staaten. Donald Trump, gerade noch US-Präsident, führt wie kein anderer vor, wie inkonsistent und unübersichtlich die neue Wirtschaftspolitik ist. Wenn es Trump gerade ins Zeug passt, reaktiviert er noch die alte antistaatliche Rhetorik. Als er etwa im Jahr 2017 das Budget für die Umweltbehörde EPA zusammenstreichen ließ, bediente er sich der altbekannten Argumentation, wonach es den Amtsschimmel zu bekämpfen gelte, der braven amerikanischen Unternehmern und Arbeitern das Leben schwer mache. Gleichzeitig liefert sich Trump Zollkriege mit China, lehnt internationale Handelsabkommen ab und befürwortet protektionistische Maßnahmen. Und: Er treibt die US-Staatsverschuldung in bislang ungekannte Höhen. Hätten demokratische Präsidenten wie Barack Obama auch nur ansatzweise so viel ausgegeben, die Republikaner hätten gar nicht drastisch genug vor dem heraufziehenden "Sozialismus" warnen können. Doch unter Trump sind Schulden kein Problem mehr. Im Übrigen dienen diese Schulden nicht bloß dem Zweck, die Corona-Krise zu bekämpfen. Trump überzog das Budget bereits vor Ausbruch der Pandemie, um mehr Mittel für das Militär und Steuersenkungen zu haben. Von Letzteren profitierten übrigens ausschließlich reiche US-Amerikaner.
Aber wie sieht der Post-Neoliberalismus nun aus - jene neue, noch namenlose wirtschaftspolitische Ausrichtung? Derzeit ist das Bild reichlich verschwommen. Antistaatliche Ansagen mischen sich umstandslos mit staatlicher Kraftmeierei; wirtschaftlicher Protektionismus im Namen der kleinen Leute geht mit steuerlicher Bevorzugung der Reichen einher. Alles geht irgendwie zusammen. Dazu passt, ironischerweise, dass die internationalen Börsen nicht etwa mit Verunsicherung auf die neue Unübersichtlichkeit reagieren, sondern mit historisch beispiellosen Höhenflügen. In Trumps USA genauso wie, etwas abgeschwächt, in Europa.
Bei aller Widersprüchlichkeit zeigt sich aber doch eine Gemeinsamkeit: Ein Eingreifen des Staates in die Wirtschaft wird eher akzeptiert als früher, teilweise wird es sogar als notwendig erachtet. Wenn man so will, kann man die neue post-neoliberale Ausrichtung als Neo-Etatismus bezeichnen.
In seinem viel beachteten Buch "Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus" wunderte sich der britische Soziologe Colin Crouch schon vor Jahren, wie es sein könne, "dass der Neoliberalismus nicht untergegangen ist". Crouchs Buch stand unter dem Eindruck der internationalen Finanzkrise der späten 2000er-Jahre. In deren Verlauf mussten zahlreiche Großbanken, deren Gebaren seit den 1980er-Jahren stark dereguliert worden war, mit Milliarden an Steuergeld vor der Pleite gerettet werden.
Am Endes seines Werks überlegt Crouch, welches alternative Modell den Neoliberalismus ersetzen könnte. Es werde nicht um "eine Rückkehr zu staatlicher Wirtschaftslenkung" gehen, schreibt er. "Sondern um eine Ökonomie, in der die vier großen Kräfte, die eine funktionierende Gesellschaft ausmachen - der Staat, der Markt, die Konzerne und die Zivilgesellschaft -, in einem gemäßigten Spannungsverhältnis zueinander stehen." Nur aus einem solchen Gleichgewicht, so Crouch, können langfristige wirtschaftliche Innovationen und neuer Wohlstand entstehen.
Die Finanzkrise hat der Neoliberalismus überlebt. An der Corona-Krise ist er gescheitert. Allerdings hat sich anstelle des alten Systems kein hübsch austariertes Gleichgewicht herausgebildet, wie es Crouch vorschwebte. Die neoliberale Ordnung hat sich verabschiedet, ohne dass eine neue in Kraft wäre. Der Neoliberalismus ist tot. Der Neo-Etatismus zeigt sich erst diffus am Horizont. Davor liegt dichter Nebel.