Es war einmal eine Wirtschaftspartei: Wie die Causa Mahrer die ÖVP ins Wanken bringt
Schriftgröße
Eine fast zwanzig Jahre lange politische Karriere geht vergangenen Donnerstag um 17 Uhr innerhalb von drei Minuten und zehn Sekunden zu Ende, per Video, aufgenommen im Christoph-Leitl-Saal im obersten Stockwerk der Wirtschaftskammer in der Wiedner Hauptstraße in Wien. Und veröffentlich auf den sozialen Netzwerken LinkedIn und Facebook. Keine Journalisten, keine Wegbegleiter – der Wirtschaftskammerpräsident nimmt alleine Abschied. Sichtlich angeschlagen wendet sich Harald Mahrer in blauem Blazer und weißem Hemd an die „Unternehmerinnen und Unternehmer“ und seine „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Ein paar Floskeln über seinen Einsatz für den Wirtschaftsstandort; eine kurze Klage über „persönliche Ressentiments und Populismus“; die Feststellung, dass dies nicht sein „Spielfeld“ sei; dann die Zusage, Wirtschaftskammer und ÖVP-Wirtschaftsbund ordentlich zu übergeben; zum Abschluss eine kurze Anleihe bei Grillparzers „König Ottokars Glück und Ende“: „Es ist ein gutes Land“ und eine „besondere Freude, für dieses Land etwas tun zu können“.
Um 17.11 Uhr bedankt sich Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann in einer Aussendung für Mahrers „Verdienste um die Republik als Staatssekretär, Bundesminister und Präsident der Österreichischen Wirtschaftskammer“. Dieser habe „in einer auch für ihn sehr schwierigen Situation eine persönliche Entscheidung getroffen“.
Nicht nur für Mahrer, auch für Stocker und die ÖVP ist es „eine sehr schwierige Situation“. Der Fall des Wirtschaftskammerpräsidenten und die Debatte um die Gagenerhöhungen der Landespräsidenten haben die Volkspartei schwer beschädigt. Mit Arbeitnehmerbund-Obmann August Wöginger ist ein weiterer Chef einer Teilorganisation rücktrittsreif. Und der Bundesparteiobmann? Christian Stocker schwieg. In der größten Krise seit dem Rücktritt von Sebastian Kurz scheint die Partei führungslos. Ist sie noch zu retten?
Bis zuletzt hatte Harald Mahrer um sein Amt gekämpft, sich noch Donnerstagvormittag gegen den Rücktritt gewehrt. In den Tagen zuvor telefonierte er mit der halben Partei, erklärte sich in Video-Konferenzen. Bei einem Gruppen-Call hielt ein Wirtschaftsbundfunktionär Mahrer vor, jede seiner öffentlichen Wortmeldungen wäre ein „Brandbeschleuniger“. Was als Debatte über die Erhöhung der Gehälter der Kammermitarbeiter um 4,2 Prozent begann, wurde mit Mahrers Auftritten zur Existenzfrage. „Die größte Angst in der Kammer ist jetzt, dass aus der Mahrer-Diskussion eine Diskussion darüber entsteht, ob es die Wirtschaftskammer in dieser Form und Größe noch braucht“, erzählt ein Funktionär, der lieber anonym bleibt. „Und ob das viele Geld effizient und im Sinne aller Mitglieder eingesetzt wird.“
„Die größte Angst in der Kammer ist jetzt, dass aus der Mahrer-Diskussion eine Diskussion darüber entsteht, ob es die Wirtschaftskammer in dieser Form und Größe noch braucht.“
Kammer-Funktionär, Anonym
Vertrauensverlust bei den Landeskammern
Nach innen verspielte Mahrer jedes Vertrauen. Bei einer Krisensitzung am Sonntag verständigten sich die Landeskammerpräsidenten nach heftigem Ringen darauf, Mahrer zu halten. Dieser müsse allerdings ein Amt zurücklegen – den Präsidentenjob im Generalrat der Nationalbank oder die Funktion des Kammerpräsidenten. Umso mehr fühlten sie sich vor den Kopf gestoßen, als Mahrer öffentlich erklärte, die Runde habe ihm einstimmig „das Vertrauen“ ausgesprochen.
Auch die als Befreiungsschlag gedachte Pressekonferenz am Montag geriet zum Fiasko. Seinen Rückzug aus der Nationalbank begründete Mahrer mit der Formulierung, „keine halben Sachen“ machen zu wollen. Nebenbei erfuhr die Öffentlichkeit, dass er als Aufwandsentschädigung in der Bank 88.000 Euro jährlich kassiert – nachdem er sich jahrelang damit gebrüstet hatte, gratis zu arbeiten.
Nach der Pressekonferenz steigt Mahrer mit drei Journalisten in den Lift. „Und, wie beurteilen Sie eigentlich die Situation? Schaut es schlecht aus?“, will er von den Berichterstattern wissen. Naja, gut jedenfalls nicht. Ob es mit dem OeNB-Rücktritt und den versprochenen Evaluierungen der Kammer getan ist? Pfuh, das wird knapp.
„Es geht um Machterhalt, zu viele Funktionäre leben zu gut in den bestehenden Strukturen.“
Kammer-Insider
Bei der anschließenden Krisensitzung ging es – wie profil von Teilnehmern erfuhr – nur um eines: Wurde Schaden von der Kammer abgewendet? Und können wir die Situation noch retten? „Sie brauchen nicht glauben, dass es da um die Frage ging, ob man sich von innen reformieren muss oder wie das bei den Unternehmen und Mitgliedern ankommt“, erzählt der Insider. „Es geht um Machterhalt, zu viele Funktionäre leben zu gut in den bestehenden Strukturen.“
Und Harald Mahrer war nicht der Präsident, der diese Strukturen in seinen sieben Jahren an der Spitze aufbrach. Im Gegenteil: Unter seiner Ägide wurde die Kammer immer fetter. Mahrer leistete sich gleich vier Generalsekretäre, zwei mehr als unter seinem Vorgänger Christoph Leitl. Regelmäßig wechselten ÖVP-Sprecher und -Politiker in die Kammer, zuletzt der ehemalige ORF-Moderator und Kurz-Kommunikator Peter L. Eppinger. Er ist jetzt Kreativdirektor bei der Wirtschaftskammer.
Das System Mahrer steht für rauschende Feste und PR-Reisen um die Welt, für maßgeschneiderte Anzüge und für undurchsichtige Erhöhungen der Gagen für Funktionäre, allen voran für die Präsidenten der Wirtschaftskammern in den Ländern. Wie profil diese Woche aus Kammerkreisen erfuhr, sollen ursprünglich weitere Erhöhungen der Funktionärsbezüge für 2026 geplant gewesen sein, und zwar ab Dezember. Nach dem öffentlichen Aufschrei war das Thema wohl schnell vom Tisch.
Saftige Gagenerhöhungen
Auch ohne neuerliche Erhöhung sind die Funktionärsbezüge großzügig – und in allen Ländern gestiegen. Zusammen budgetierten die Landeskammern für 2024 mehr als 27 Millionen Euro für die Funktionärsentschädigung (inklusive der Bundeskammer), um 1,5 Millionen Euro mehr als im Jahr davor. Der Gehaltsrahmen der Landespräsidenten liegt bei 14.075 Euro, zwölf Mal jährlich. Wiens Wirtschaftskammerchef Walter Ruck und der Niederösterreicher Wolfgang Ecker schöpfen diesen Rahmen voll aus. Die Tirolerin Barbara Thaler, eine der schärfsten Kritikerinnen Mahrers, fällt mit einer Monatsgage von 10.400 Euro brutto zwar unter diese Grenze, ihr Einkommen stieg aber zuletzt um satte 60 Prozent. Mahrer verdiente 15.000 Euro im Monat. Rechnet man seine Gagen aus der Nationalbank und dem Wirtschaftsbund hinzu, betrug sein Monatssalär (zwölfmal) 28.500 Euro.
„Die Kammer wird als aufgeblähter, teurer Apparat wahrgenommen, der die Interessen von Großunternehmen und der Mineralölwirtschaft vertritt.“
Sabine Jungwirth, Grüne Wirtschaft
Die „Grüne Wirtschaft“ veröffentlicht auf ihrer Homepage Zahlen zu den Landeskammer, den Funktionärsbezügen und den Einnahmen aus den unterschiedlichen Umlagen. Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der „Grünen Wirtschaft“: „Wir steigen jetzt nicht in die Neiddebatte ein, denn die Höhe der Funktionsentschädigung für die Präsidenten und Präsidentinnen muss im Zusammenhang mit ihrer Inanspruchnahme beurteilt werden. Es handelt sich bei ihnen um einen Fulltime-Job.“ Aber: „Die Kammer wird als aufgeblähter, teurer Apparat wahrgenommen, der die Interessen von Großunternehmen und der Mineralölwirtschaft vertritt.“ Jungwirth fordert zwar keine grundsätzliche Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft, aber eine deutlich schlankere Kammer nach deutschem Vorbild. Dort besteht ebenfalls eine Pflichtmitgliedschaft, doch viele Unternehmen müssen keine Beiträge zahlen, da die Gewinn- und Bezugsgrenzen für die Beitragspflicht so hoch angesetzt sind.
Der König ist tot, es lebe die Königin
Beste Chancen, Harald Mahrer an der Spitze von Wirtschaftskammer und ÖVP-Wirtschaftsbund zu beerben, hat die oberösterreichische Kammerpräsidentin Doris Hummer. Als Kandidatin wird ÖVP-intern auch die Salzburger ÖVP-Nationalratsabgeordnete Tanja Graf genannt. Interimistisch übernimmt die jetzige Vizepräsidentin Martha Schultz, Tourismus-Großunternehmerin aus dem Zillertal, die Führung der Wirtschaftskammer.
Zwischenlösung
Die Tiroler Unternehmerin und bisherige Vizepräsidentin der WKO, Martha Schulz, übernimmt nach Mahrer interimistisch die Führung. Sie muss die Kammer jetzt in ruhigere Fahrwasser führen und aus der Schusslinie bringen, um weiteren Schaden abzuwenden.
Zu Beginn wird sie sich wohl Mahrers Prestigeprojekte genauer ansehen müssen. Ein Beispiel: 2020 wurde die eLearning-Plattform „wise up“ für Unternehmen ins Leben gerufen. Diese wird von der „Bildungsplattform der Wirtschaftskammer Österreich GmbH“ betrieben, die Kammer ist mit 60 Prozent daran beteiligt, der Rest entfällt auf die neun Landeskammern. Die Website preist „das größte E-Learning-Angebot im deutschsprachigen Raum an“. Unternehmerinnen und Unternehmer können dort virtuelle Kurse für sich oder ihre Belegschaft buchen – von KI-Tools für die Content-Erstellung bis zur Selbstmotivation. 13 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. 30.000 Unternehmen hätten sich eigenen Angaben zufolge auf der Plattform registriert. Allein: Die Betreiber-Gesellschaft schreibt seit ihrem Bestehen durchgehend Millionen-Verluste. 2024 waren es laut Firmenbuch (Wirtschaftscompass) 4,2 Millionen Euro. „Seit Wochen läuft ein gemeinsamer Evaluierungsprozess mit den Landeskammern, dessen Ergebnis die Grundlage für die weitere Entwicklung des digitalen Bildungsangebotes der WKO bildet“, schreibt ein Sprecher auf Nachfrage.
Ein weiteres, kostspieliges Lieblingsprojekt Mahrers, das sehr viel Geld verschlingt, soll die „Bold Community“ sein. „Ziel ist es, Innovation und internationale Zusammenarbeit zu fördern, um Österreich auf der globalen Innovationslandkarte zu positionieren“, schreibt ein Sprecher auf die Frage, was die „Bold Community“ eigentlich leisten soll. Am 5. November fand im Wiener Palais Auersperg „The Bold Experience“ statt, eine internationale Netzwerkkonferenz mit 100 nationalen und internationalen Gästen aus Politik und Wirtschaft. Rund 70 Events, teilweise im Ausland, wurden seit 2022 veranstaltet. Kostenpunkt pro Jahr: 1,2 Millionen Euro.
Neben der Wirtschaftskammer muss nun auch der Wirtschaftsbund dringend reformiert werden. Unter den sechs Teilorganisationen der Volkspartei ist dieser mit 100.000 Mitgliedern neben Bauernbund und Arbeitnehmerbund (ÖAAB) der mächtigste, der finanziell stärkste ist er jedenfalls. Nach den Turbulenzen um Mahrer mehrten sich Berichte über erboste Mitglieder, die sich bei ihren lokalen Wirtschaftsbund-Funktionären beschwerten oder gar ihren Austritt erklärten. Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger war einer der letzten, der seinem Chef die Treue hielt, auch aus Eigeninteresse: Mit Mahrers Fall wird nun auch Egger gehen – was nicht wenige Wirtschaftsbundmitglieder begrüßen. Unter Eggers Management hat die Unternehmerorganisation in der ÖVP an Einfluss verloren.

© Bildbearbeitung: Schillinger; Alexandra Unger
Stockers Schweigen
ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker äußerte sich lange Zeit nicht zur Causa-Wirtschaftskammer. Mahrers Rücktritt wirft jetzt aber seinen Schatten auf den Kanzler.
Zunächst hatten die ÖVP-Spitzen gehofft, die Affäre würde sich auf die Wirtschaftskammer beschränken. Christian Stocker zog es daher vor zu schweigen. Aber schon bald war klar, dass sich die Causa zu einer Affäre der ÖVP auswachsen würde. Stocker schwieg weiterhin, ließ am Mittwoch aber seinen Generalsekretär Nico Marchetti ausrücken: „Ja, es sind Fehler passiert. Harald Mahrer hat nun Reformen in der Wirtschaftskammer angekündigt. Wir trauen ihm zu, dass er diese auch umsetzen kann.“ Dürrer ging es nicht mehr. ÖVP-intern wurde das Statement als Pflichtübung gewertet, um etikettengemäß Restsolidarität mit dem Obmann einer wichtigen Teilorganisation zu demonstrieren. Der Kanzler ist nach seiner Rückenoperation noch rekonvaleszent und führt die Amtsgeschäfte von seinem Haus in Wiener Neustadt aus. An der Ministerratssitzung vergangenen Mittwoch nahm er per Video-Schalte teil. Langes Sitzen bereitet ihm nach wie vor Probleme.
Mangel an Parteifreunden
Irgendwann in den vergangenen Tagen muss Harald Mahrer aufgefallen sein, dass er so gut wie keine Freunde in der Partei hat. Seit der gelernte PR- und Strategieberater 2018 das Präsidentenamt von Christoph Leitl übernommen hatte, gefiel er sich in der Rolle des Strategen und Strippenziehers, der den Parteifreunden – vom jeweiligen Bundeskanzler abwärts – die Welt erklärt. Tatsächlich verstand Mahrer auch sehr viel von dieser Welt, ließ aber andere gern spüren, sich für den Klügsten zu halten.
Die Königsallüren des Chefs waren in der Wirtschaftskammer gefürchtet. Mahrer verschliss laufend Chauffeure und Sekretärinnen. Sein Umgangston war schroff. Als er eine Delegation von Wirtschaftstreibenden nach Japan begleiten sollte, sagte er wenige Tage vor der Abreise einfach ab.
Oft fehlte ihm, dem PR-Unternehmer, das richtige Gespür. Im Mai 2020, während der Corona-Krise, appellierte er in einem Interview mit dem Gourmet-Magazin „Falstaff“, man müsse wieder „Lust auf Konsum, Lust aufs Essengehen, Lust auf Gourmet-Weekends, Lust auf Shopping“ entwickeln. Dazu ließ er sich mit einer Magnum-Flasche Wein abbilden, während tausende Unternehmer landauf, landab um ihre Existenz bangten. Geschichten über üppige Spesen sind im Umlauf. Eine Anfrage, ob der Wirtschaftsbund ein Fest zu Mahrers 50. Geburtstag finanzierte, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.
Mahrers Wert für die ÖVP bestand darin, über die Sozialpartnerschaft Kommunikationskanäle zu Gewerkschaft und SPÖ aufrechtzuerhalten. Bei einigen hochrangigen roten Kadern ist er aber alles andere als wohlgelitten. Dass die erste Runde der schwarz-rot-pinken Koalitionsverhandlungen an inhaltlichen Zwistigkeiten zu Jahresbeginn scheiterte, lasten sie Mahrer an. Allerdings: Am Ende war es der Wirtschaftskammerpräsident, der mit ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian tatkräftig mithalf, die Dreierkoalition im zweiten Anlauf auf den Weg zu bringen.
Mahrer sah sich stets als Visionär und Vordenker, der regelmäßig schmale Bände – er selbst nannte es lieber „Schriftwerk“ – über Eigentum, Freiheit und Liberalismus verfasste. An den intellektuellen Innovator wird sich kaum jemand erinnern. Übrig bleibt das Bild eines Multifunktionärs aus uralten Zeiten mit hoher Gage und einer christlich-sozialen Partei, deren oberste Wirtschaftsvertreter Nehmen für seliger halten als Geben.

© Bildbearbeitung: Schillinger; APA/ROLAND SCHLAGER
Rücktrittsreif?
Die ÖVP hat noch gar nicht Causa August Wöginger und die verpatzte Diversion verarbeitet, jetzt muss sie sich auch noch mit den Folgen von Mahrers Abgang beschäftigen.
Im Gegensatz zu Harald Mahrer konnte sich der Obmann des ÖAAB, Klubobmann August Wöginger, auf die Solidarität der Partei verlassen, obwohl sein Fall wesentlich krasser ist. Bei Mahrer geht es um fehlendes politisches Gespür, bei Wöginger um strafrechtliche Vorwürfe der Bestimmung zum Missbrauch der Amtsgewalt. Nach wie vor schwebt über dem Klubobmann die Gefahr, wegen Postenschachers verurteilt zu werden. Der Klubobmann setzte sich bekanntlich dafür ein, dass ein minderqualifizierter ÖVP-Bürgermeister aus seinem Heimatbundesland Oberösterreich Chef des Finanzamts Braunau wurde. Das Landesgericht Linz bot Wöginger im Oktober eine Diversion an. Dieser bezahlte 44.000 Euro Geldbuße und blieb damit unbescholten. Doch die Oberstaatsanwaltschaft Wien erteilte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Weisung, die Diversion anzufechten. Nun prüft das Oberlandesgericht Linz, ob diese gerechtfertigt war. Die ÖVP-Spitze stellte bereits klar, Wöginger auch bei einer erstinstanzlichen Verurteilung zu halten. Der gesellige „Gust“ ist in der Partei überaus beliebt. Nun könnte ausgerechnet Mahrers Rückzug auch Wöginger unter Druck setzen. Wenn der Wirtschaftskammerpräsident wegen einer – im Vergleich zu strafrechtlichen Vorwürfen –Lappalie als untragbar gilt, müsste dasselbe auch für den Klubobmann gelten.
Ende der Wirtschaftspartei
Aus den Reihen des Wirtschaftsbunds gab es in den vergangenen Jahren Kritik an Wöginger. Als ÖAAB-Obmann habe dieser immer wieder bei den ÖVP-Bundeskanzlern kostspielige Wohltaten für die Arbeitnehmerschaft wie die Valorisierung der Familienleistungen durchgesetzt. Ex-Finanzminister Magnus Brunner macht Wögingers Interventionen noch heute für das explodierende Budgetdefizit mitverantwortlich. Hauptverantwortlich sind freilich Brunner & Co, die den Begehrlichkeiten aus eigenen Reihen zu wenig entgegensetzten.
Den ÖVP-Wirtschaftsministern wiederum gelang es in den vergangenen Jahren nicht, die notwendigen Impulse für mehr Wachstum zu setzen. Die ÖVP war einmal eine Wirtschaftspartei. Noch ist sie Kanzlerpartei. Wie lange wird sie das bleiben können?
Die Umfragen sind derzeit alles andere als rosig. Die ÖVP liegt bei 21 Prozent und damit unter ihrem Ergebnis bei der Nationalratswahl 2024 (26,3 Prozent). Dass die SPÖ nur noch auf 17 Prozent kommt, ist ein schwacher Trost. Da die Regierung in den kommenden Jahren nichts zu verteilen hat, sondern bei den Bürgern einsparen muss, werden sich die Werte der Volkspartei kaum verbessern. Der deplorable Zustand im Bund schlägt auch auf die Landesparteien durch. In der Steiermark verlor die ÖVP vor einem Jahr den Landeshauptmann-Posten an die FPÖ. In Oberösterreich droht Landeshauptmann Thomas Stelzer 2027 das gleiche Schicksal. Mit Eisenstadt stellt die ÖVP nur noch in einer Landeshauptstadt den Bürgermeister.
Die Analyse der Nationalratswahl zeigte, dass die ÖVP nur bei Pensionisten und Unternehmern stärkste Partei ist. Letztere werden nach der Affäre in der Wirtschaftskammer wohl in Scharen von ihrer Stammpartei abfallen. Nutznießer wird FPÖ-Obmann Herbert Kickl sein, dem Harald Mahrer ein „vorzeitiges Christkindl“ bescherte, wie es der Politikberater Thomas Hofer im ORF formulierte.
Die ÖVP wurde mittlerweile auf ihre Kernklientel – neben den Pensionisten vor allem die Landwirtschaft – dezimiert. Eine Volkspartei im weiteren Sinn, die alle Bevölkerungsschichten und gesellschaftlichen Gruppen ansprechen will, ist sie längst nicht mehr. Auf Bundesebene ist die Partei nur noch ein Gerippe, in ihrer Existenz real bedroht. Dass sie noch eine nennenswerte politische Kraft ist, verdankt die ÖVP ihren Strukturen am Land mit ihren tausenden Bürgermeistern und kleinen Funktionären. In den großen Städten ist sie zur Kleinpartei verkümmert. Bei der Wiener Gemeinderatswahl im April kam sie auf desaströse 9,65 Prozent.
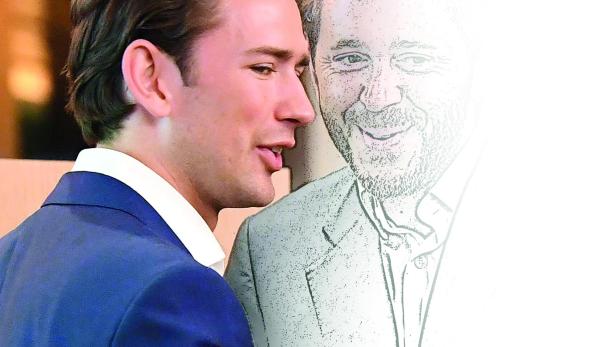
© Bildbearbeitung: Schillinger, APA/HELMUT FOHRINGER
Ära Kurz
Mahrer war innerhalb der Wirtschaftskammer als "Kurzianer" verschrien. Es war kein Geheimnis, dass Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kein großer Freund der Sozialpartnerschaft war.
Die ÖVP hat sich zur Partikularinteressensvertretung verengt. Nach wie vor hält sie am so genannten „Dieselprivileg“, der steuerlichen Besserstellung von Dieselkraftstoff im Vergleich zu Benzin, fest, obwohl die Subvention klimaschädlich ist und dem Fiskus geschätzt zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro jährlich entgehen. Die Protektion der Bauern und Frächter ist der ÖVP wichtiger.
Mangelnden Sinn fürs Gemeinwohl zeigt die ÖVP auch bei der so genannten Flat-Tax für Pensionisten, die in der Rente weiterarbeiten wollen. Deren Einkommen soll mit nur 25 Prozent versteuert werden. Davon würden vor allem Spitzenverdiener, Selbstständige und Freiberufler profitieren. Die Flat-Tax soll bereits ab Jahresbeginn 2026 gelten und wird das Budget nächstes Jahr mit 300 Millionen Euro belasten, 2027 mit 460 Millionen. Wirtschaftsexperten in Wifo, IHS und im Fiskalrat halten sie angesichts der horrenden Defizite für eine Schnapsidee, die vor allem vom Wirtschaftsbund forciert wurde.
Harald Mahrer muss nun ins zivile Leben als Unternehmer zurückfinden. Der zurückgetretene Kammerpräsident ist Aufsichtsrat eines Herstellers von Mehrfamilienhäusern aus Holz und geschäftsführender Alleingesellschafter der HM Tauern Holding Beteiligungs-GmbH, deren Geschäftstätigkeit bisher allerdings gegen Null tendiert.
Fest steht: Für seinen früheren Beruf als Kommunikations- und Strategieberater ist Harald Mahrer angesichts des eigenen PR-Debakels denkbar ungeeignet.

Gernot Bauer
ist seit 1998 Innenpolitik-Redakteur im profil und seit 2025 Leiter des Innenpolitik-Ressorts. Co-Autor der ersten unautorisierten Biografie von FPÖ-Obmann Herbert Kickl.

Marina Delcheva
leitet das Wirtschafts-Ressort. Davor war sie bei der "Wiener Zeitung".




