Putins Angriffe auf Europa: Krieg ohne Waffen
Schriftgröße
Mitte der 1990er-Jahre sitzt Alexander Dugin in Moskau am Manuskript eines neuen Buches und formuliert Sätze, die bis heute nachhallen. Es sei notwendig, „den Feind so weit wie möglich zu schwächen, zu demoralisieren, zu täuschen und letztendlich zu besiegen“, schreibt der rechtsextreme Ideologe in seinem Buch „Grundlagen der Geopolitik“. Der Feind, das sind die USA, und Dugin rät, „ethnische, soziale und rassische Konflikte, alle dissidenten Bewegungen extremistischer, rassistischer und sektiererischer Gruppen“ zu fördern und zu unterstützen, um die „innenpolitischen Prozesse in den USA zu destabilisieren“.
Dugins innerhalb wie außerhalb Russlands viel beachtetes Werk erschien bereits 1997, doch seine Thesen lesen sich wie aus dem aktuellen Strategiepapier des Kremls. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat Moskau seine Angriffe auf den Westen massiv hochgefahren. In Europa versucht Russland mittels Sabotage, Desinformation, Cyberangriffen und Spionage die Regierungen und die NATO zu schwächen, Angst und Schrecken in der Bevölkerung zu verbreiten und die Unterstützung für die Ukraine zum Bröckeln zu bringen.
„Gibridnaya voyna“, wörtlich „hybride Kriegsführung“, beschreibt das Zusammenspiel zwischen konventionellem Krieg und dem Kampf ohne Waffen. Russland hat, wenn man so will, einen ganzheitlichen Zugang. „Die doppelte Zielsetzung, einerseits reale Sachverhalte zu beseitigen, etwa die Hilfslieferungen für die Ukraine, und andererseits auf die öffentliche Meinung einzuwirken, ist nichts Neues“, sagt der Historiker Wolfgang Mueller von der Universität Wien. Letzteres sei früher über sowjetische Vorfeldorganisationen geschehen. Heute laufen Propaganda und Desinformation hauptsächlich über soziale Medien.
Dort lanciert der Kreml Desinformationskampagnen, verhöhnt seine Gegner und hetzt seine Trolle auf unliebsame Politiker und Oppositionelle. In der realen Welt rekrutieren russische Geheimdienste Agenten, die militärische Einrichtungen ausspionieren und Feuer an logistischen Knotenpunkten legen. Viele dieser Sabotageakte sind dem Kreml nicht eindeutig nachweisbar, das macht sie für Russland besonders attraktiv. Das Leugnen von Aktionen ist ein zentraler Bestandteil im hybriden Krieg Moskaus.
Moskau nutzt die Grauzone zwischen Krieg und Frieden.
Russland-Experte Gerhard Mangott
„Moskau nutzt die Grauzone zwischen Krieg und Frieden“, sagt der Russland-Experte Gerhard Mangott: „Man will dem Gegenüber so schwer wie möglich schaden, ohne in einen offenen militärischen Konflikt zu gehen.“ Die renommierte Londoner Denkfabrik „International Institute for Strategic Studies“ (IISS) hält in einer Ende August erschienenen Analyse fest, dass Russland seine Ziele erreichen wolle, „ohne einen konventionellen Konflikt auszulösen, von dem es weiß, dass es gegenüber der NATO unterlegen ist“.
Wie geht Moskau in seinem hybriden Krieg gegen Europa vor? Welche Schwachstellen nutzt Russlands Präsident Wladimir Putin, um Europa zu destabilisieren? Und wie kann sich Europa schützen?
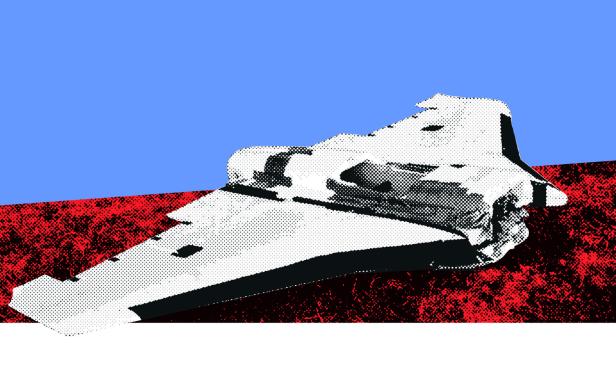
Russische Drohne
© Illustration: Irma Tulek; Fotos: Shutterstock
Russische Drohne
Leugnen, täuschen, verhöhnen
Die NATO wurde vor 75 Jahren gegründet, das Militärbündnis hat mittlerweile 32 Mitgliedstaaten, 30 davon in Europa. Doch nicht einmal auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges passierten Provokationen im Luftraum der NATO, die mit jener zu vergleichen wären, die sich in der Nacht auf den 10. September am Himmel über Polen ereignete: 19 Drohnen drangen teils tief ins Land ein, einige davon kamen aus Belarus, einem politischen und militärischen Trabanten Russlands. Wenige Tage später tauchten zwei Drohnen in Rumänien auf, kurz darauf flogen weitere über das Schloss Belvedere in Warschau, den Sitz des Präsidenten.
Russland bekannte sich nicht zu den Aktionen, es leugnete sie aber auch nicht direkt. Stattdessen praktiziert der Kreml politisches Gaslighting: leugnen, täuschen, verhöhnen. Hätte Russland wirklich Schaden anrichten wollen, hätte es dies auch getan, tönt es in russischen Staatsmedien.
Solche Aktionen, die nicht zu 100 Prozent zuordenbar sind, fungieren wie ein Test, um die Reaktion des Gegners zu erkunden – ohne dabei aus der Deckung zu gehen. Russland will eine Atmosphäre herbeiführen, in der die Devise für den Feind lautet: zu viel für Frieden, zu wenig für offenen Krieg. Die europäischen Regierungen haben weitgehend entschieden, dass sie sich nicht „im Krieg“ befinden, dass Russlands Aktivitäten in der Grauzone bleiben und die Schwelle des NATO-Artikels 5 wahrscheinlich nicht erreichen werden – zumindest vorerst. Artikel 5 würde die Beistandspflicht der anderen Staaten auslösen, in der Geschichte der NATO kam dies erst ein einziges Mal vor, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.
Wenn der Feind in unserem Kopf ist, hat er schon gewonnen.
Militärexperte Oberst Markus Reisner
Die jüngste Eskalation ist dennoch auch formell nicht unbedeutend – immerhin berief sich Polen auf Artikel 4, der eine Konsultation der NATO-Bündnispartner erfordert, wie zuletzt gemeinsam mit anderen NATO-Staaten nach der russischen Invasion vom
24. Februar 2022 in der Ukraine. Mit einer militärischen Antwort hielt sich Europa bisher zurück, wohl aus Angst vor einer Eskalation.
Doch das Verwirrspiel geht weiter. Zu Russlands Taktik gehört nicht nur Täuschung auf dem Schlachtfeld, sondern auch das Stiften von Verwirrung in den gegnerischen Gesellschaften und Öffentlichkeiten. Zur Methode, diese von innen zu schwächen, zählen Spaltung und die Stärkung der Extreme an den politischen Rändern. In der hybriden Kriegsführung ist Desinformation eines der wichtigsten Tools – und sie hat massive Auswirkungen. „Wenn der Feind in unserem Kopf ist“, sagt der Militärexperte Markus Reisner vom Österreichischen Bundesheer, „hat er schon gewonnen.“
Nach dem Drohnenschwarm in Polen servierten russische Militärblogger in den sozialen Medien ihre Version der Wahrheit: Über Polen seien UFOs gesichtet worden, höhnte „Fighterbomber“ auf Telegram. Andere bedauerten, dass bei der Aktion kein Schaden entstanden war. Blogger und Influencer übernehmen mittlerweile jene Aufgaben, die einst russische Trolle und automatisierte Bots erledigten: die Unterwanderung der öffentlichen Meinung – auch im Westen.
Stören, spionieren, sabotieren
Sie legen Feuer in Shoppingzentren, bringen Kameras entlang wichtiger Eisenbahnstrecken an oder kippen Metallspäne in den Antrieb deutscher Kriegsschiffe: Seit 2022 gab es in Europa geschätzt mehr als 500 Hybridaktionen, und sehr oft kamen dabei sogenannte Wegwerfagenten zum Einsatz. Weil nach Beginn der Invasion in der Ukraine Hunderte russische Diplomaten – und damit auch viele gut ausgebildete Agenten – aus der EU ausgewiesen wurden, rekrutieren russische Geheimdienste mittlerweile Laien über den Messengerdienst Telegram. Diese sind zwar nicht ausgebildet, doch Moskau geht mit ihnen auch kein Risiko ein: Werden die Amateurspione erwischt, ist nicht nachweisbar, wer hinter den Aufträgen steckt.
Russische Angriffe auf die kritische Infrastruktur Europas gab es zwar immer wieder, neu ist aber ihre Häufung. Laut IISS hat sich die Anzahl der Sabotageaktionen in den vergangenen zehn Jahren beinahe vervierfacht. Von 2023 auf 2024 verzeichnet die Denkfabrik einen Anstieg um 246 Prozent.
Allein in Polen und Deutschland wurden 40 Fälle von versuchter oder tatsächlicher Brandstiftung mit Russland in Verbindung gebracht, darunter die Zerstörung eines Einkaufszentrums in Warschau.
Im Fokus stehen auch europäische Rüstungskonzerne. Im Mai 2024 brach ein Großfeuer in der Fabrik der Diehl Group in Berlin aus, die Waffen auch für den Export in die Ukraine herstellt. Und gegen den Chef des wichtigsten deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall scheint es sogar konkrete Mordpläne gegeben zu haben. Laut dem US-Sender CNN waren es amerikanische Nachrichtendienste, die Pläne der russischen Regierung zur Ermordung Armin Pappergers aufdeckten.
Für Moskau hat die Unterwerfung der Ukraine oberste Priorität.
Russland-Experte Wolfgang Mueller
In den Einrichtungen der NATO in Europa gab es in den ersten fünf Monaten dieses Jahres bereits 25 Fälle von Sabotage, Spionage und Vandalismus. Hauptverdächtige sind auch hier häufig Männer mit Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion, die über das Internet angeworben wurden. Festgenommen wurden Ende vergangenen Jahres etwa drei Männer aus Bayreuth. Sie sollen im Auftrag Moskaus Rüstungsbetriebe und Militäranlagen ausspioniert und Anschläge auf Bahngleise geplant haben. Laut Bundesanwaltschaft mit dem Ziel, die militärische Unterstützung Berlins für die Ukraine zu unterminieren.
„Für Moskau hat die Unterwerfung der Ukraine oberste Priorität“, sagt dazu Russland-Experte Mueller – dicht gefolgt von einer Änderung der politischen Landschaft in Europa: durch die Stärkung extremistischer Kräfte, das Aufwiegeln gesellschaftlicher Konflikte und damit die Untergrabung der Einheit des Westens und seiner freiheitlichen Ordnung.

© Illustration: Irma Tulek; Fotos: APA/AFP/EVGENIA NOVOZHENINA
Verbrüdern, verwirren, kalmieren
Rechte Kräfte in Europa schweigen eisern zu russischen Aktivitäten und militärischen Grenzverletzungen wie Drohnenangriffen und Spionagefällen. Das ist einigermaßen bemerkenswert, immerhin pochen diese Parteien auf die Wahrung und Integrität territorialer Grenzen und propagieren eine „Festung Europa“.
Dazu gehören nicht nur Politiker an den Außengrenzen der EU, wie Serbiens Präsident Aleksandar Vučić oder Milorad Dodik, der Präsident der Republika Srpska (einer Entität von Bosnien und Herzegowina), der offen für die Abspaltung vom Gesamtstaat agitiert und dabei den Beistand Russlands herbeiruft. Sondern auch Kräfte innerhalb der EU, die bei Wahlen sehr erfolgreich sind, zutiefst kremlfreundlich auftreten und daraus kein Hehl machen.
Etwa die FPÖ, mittlerweile stärkste Parlamentspartei in Österreich. Ihr Freundschaftsvertrag mit Putins Partei „Einiges Russland“ mag mit der Zeit zur Makulatur verkommen sein, Gemeinsamkeiten sind aber nicht von der Hand zu weisen. Im Angesicht des Abwehrkampfes der Ukrainer gegen den russischen Aggressor kapriziert sich der blaue Beinahe-Kanzler Herbert Kickl auf die Neutralität und ist dezidiert gegen einen Beitritt Österreichs zur NATO – den seine eigene Partei noch vor Jahren gefordert hatte. Und Kickl ist auch dafür, dass durch österreichische Pipelines wieder russisches Gas fließt.
Ähnlich tönt Ungarns Premier Viktor Orbán. Er lehnt jegliche Militärhilfen für die Ukraine sowie Sanktionen gegen Moskau ab und ist der Meinung, dass Russland den Krieg ohnehin bereits für sich entschieden habe. Auch Robert Fico, der zumindest nominell sozialdemokratische Ministerpräsident der Slowakei, fordert eine Normalisierung der Beziehungen zu Moskau.
Die Chefin des rechtsextremen französischen „Rassemblement National“ Marine Le Pen, die im Frühjahr wegen Veruntreuung verurteilt wurde, sei Opfer einer Politjustiz, so Kremlsprecher Dmitri Peskow: „Unsere Beobachtungen in den europäischen Hauptstädten zeigen, dass man keineswegs zurückhaltend ist, im politischen Prozess die Grenzen der Demokratie zu überschreiten.“
Auch das gehört zum russischen Drehbuch: sich selbst als Verfechter der Demokratie gerieren, der um diese besorgt ist. „Verwirrung stiften und sich als Freund darstellen“, sagt dazu Oberst Reisner.
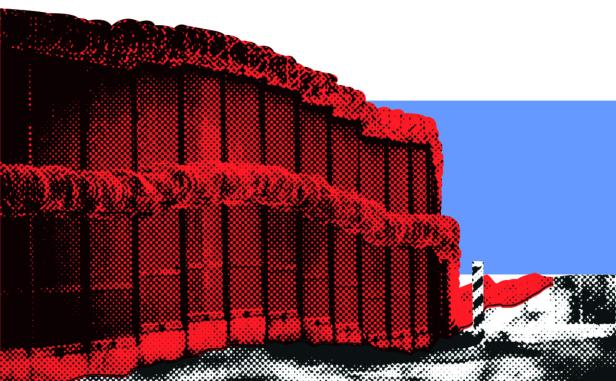
© Illustration: Irma Tulek; Fotos: APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI
Spalten, destabilisieren, schwächen
Russland versucht Europa auch gezielt über Migration zu destabilisieren. Seit dem Jahr 2021 versucht der Kreml, die Europäische Union über diese Flanke zu schwächen. Die sogenannte Eastern Borders Route, die über Belarus und Länder wie Polen geht, verzeichnete in den vergangenen Jahren die größten Zuwächse bei illegalen Grenzübertritten.
Während die Migration auf der viel diskutierten Zentralen Mittelmeerroute laut der EU-Grenzschutzagentur Frontex von 2023 auf 2024 um 59 Prozent abnahm, gab es auf der Ostroute über Belarus einen Zuwachs von 192 Prozent. Oftmals sind es Menschen aus arabischen Staaten, die mit russischen Visa nach Belarus gelangen und von dort aus in die EU übersetzen wollen. Polen hat einen knapp 200 Kilometer langen Zaun errichtet, um sich zu schützen.
Die europäische Politik erkennt das Problem und benennt es unverblümt. „Russland missbraucht Migranten in seinem hybriden Krieg gegen Europa“, sagt der ehemalige österreichische Finanzminister und nunmehrige EU-Migrationskommissar Magnus Brunner im Interview mit profil. „Ich war selbst dort: Weißrussische Offiziere kommen mit Migranten an die Grenze, schneiden den Zaun zu Polen auf, schieben die Migranten durch und verschwinden wieder.“

© Illustration: Irma Tulek; Fotos: APA/AFP/ANTTI AIMO-KOIVISTO;
Eindringen, verstören, zerstören
Mit wenig Budget größtmöglichen Schaden anrichten – so lassen sich die Vorteile der hybriden Kriegsführung für Moskau zusammenfassen.
Ein gutes Beispiel ist die Sabotage von Strom- und Datenkabeln in der Nord- und Ostsee. Mit ihren Ankerketten durchschlagen die Schiffe der russischen Schattenflotte die Unterwasserkabel, von denen Europas Wirtschaft abhängt und über die jeden Tag Finanztransaktionen im Ausmaß von Billionen Dollar laufen. Die Kosten für die Reparatur eines einzelnen Kabels liegen bei zig Millionen Euro, der wirtschaftliche Schaden durch den Ausfall der Datenübertragung dürfte noch höher sein.
Ohne die Unterwasserkabel gibt es kein Internet und keinen internationalen Zahlungsverkehr, doch das Gebiet, durch das sie verlaufen, ist zu groß, um es zu überwachen. Außerhalb von Territorialgewässern, also dort, wo die meisten Kabelkilometer liegen, könnten europäische Militärs russische Schiffe ohnehin nicht vertreiben. Geplant ist der Einsatz von Unterwasserdrohnen, damit wenigstens klar ist, was unter Wasser geschieht – und Saboteure im besten Fall erwischt werden.
Zum unsicheren Gewässer ist die Ostsee auch für Europas Reeder geworden. Sie berichten beinahe täglich von der Störung oder dem kompletten Ausfall ihrer Navigationssysteme. Verantwortlich sind Cyberangriffe auf das satellitengestützte GPS oder sogenannte Jamming-Attacken, bei denen Störsender den Empfang von Signalen blockieren und keine Navigationsdaten mehr verfügbar sind. Schiffe sind dann nicht mehr manövrierfähig, und die Gefahr von Kollisionen steigt. Den Kapitänen bleibt nichts übrig, als auf Kompass und Radar zurückzugreifen.
Auch bei den Störangriffen in der Ostsee gilt: Wer dahintersteckt, lässt sich nicht eindeutig nachweisen. Sicher ist nur, dass sie seit dem russischen Überfall auf die Ukraine deutlich zugenommen haben.
Das gilt auch für Cyberangriffe auf europäische Behörden, Unternehmen und Parteien. Die deutsche Bundeswehr ist laut deren Experten für Cybersicherheit nahezu täglich Cyberangriffen ausgesetzt, betroffen sind auch Rüstungskonzerne und deren Zulieferer. Vergangenen Mai gab es einen schweren Hackerangriff auf die deutsche SPD, und das Außenministerium in Wien wurde im August Opfer eines Datenlecks.
Wenn Europa verstanden werden will, sollte es seinen Willen zur Verteidigung eindeutig kommunizieren.
Russland-Experte Wolfgang Mueller
Russland-Experte Mangott geht davon aus, dass die Angriffe im Bereich der Sabotage und der Cyberkriegsführung weiter zunehmen werden.
Wie kann Europa auf all diese Attacken antworten?
Maßnahmen zur Stärkung der kritischen Infrastruktur, der Sicherheit im virtuellen Raum, an Europas Ostgrenze sowie in europäischen Gewässern sind angelaufen, doch die Frage, wie man Russland begegnen soll, ist zuallererst eine politische. „Putin spricht die Sprache der Stärke“, sagt der Historiker Mueller, „Wenn Europa verstanden werden will, sollte es seinen Willen zur Verteidigung eindeutig kommunizieren.“ Solange die Ukraine nicht so weit unterstützt werde, dass sie sich mit allen Mitteln verteidigen kann, werde der Konflikt weitergehen. „Der Westen hat die ersten beiden Kriegsjahre rüstungstechnisch verschlafen. Jetzt muss es umso schneller gehen.“
Und es geht längst nicht nur um die Verteidigung der Ukraine. Auf dem Spiel steht nicht weniger als die Sicherheit der Europäischen Union.
Oberst Markus Reisner vom Österreichischen Bundesheer rät, Europas Demokratien vor externer Einflussnahme und Desinformation zu schützen und aktiv zu stärken: „Das erfordert ein entschlossenes Vorgehen gegen alle, die unsere demokratischen Grundwerte und Freiheiten infrage stellen.“ Moskau arbeite auch mit kognitiver Kriegsführung, um dem Angegriffenen einzureden, dass der Angreifer in Wahrheit gar nicht sein Feind wäre.
Alexander Dugin versteht den Begriff „Feind“ in seinen „Grundlagen der Geopolitik“ als „rein politisches Konzept“. Er habe „keine moralische Kraft“, steht dazu im Glossar. Bemerkenswerterweise ist der Terminus „Freund“ dort wortgleich definiert. Die Linie zwischen den Gegensätzen verschwimmt, die Grauzone wird zur Realität – wie in Putins Schattenkrieg gegen Europa.

Siobhán Geets
ist seit 2020 im Außenpolitik-Ressort und seit 2025 stellvertretende Ressortleiterin. Schwerpunkt: Europa und USA.

Nina Brnada
Redakteurin im Österreich-Ressort. Davor Falter Wochenzeitung.











